Von Peter Hossli
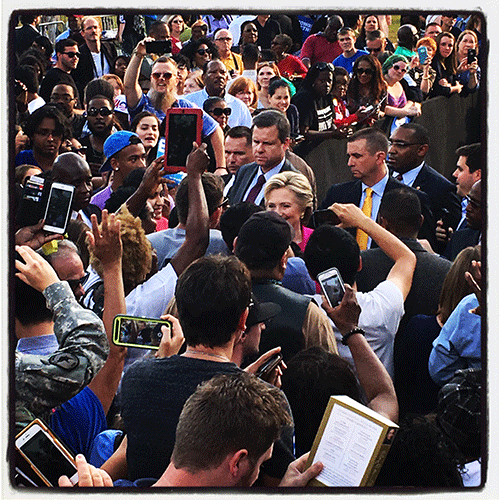
Nichts von alldem. Sie schweigen einander an. Alle zücken das Smartphone. Ihre modischen Skijacken und -hosen haben dafür eigens passende Taschen. Gesenkten Hauptes checken sie Mails, betrachten Videos, prüfen das Wetter. Einer flirtet – offenbar mit einer Frau, die sich gerade irgendwo sonst auf der Welt aufhält.
Alle vier verstecken sich hinter Glas und Metall. Alle vier tippen mit speziellen Handschuhen, die den Touchscreen der Telefone steuern können.
In der idyllischen Berglandschaft wird klar: Der Flirt ist tot, zur Strecke gebracht vom klugen Telefon.
Neulich in Washington D.C. Der neue US-Präsident Donald Trump (70) wird vereidigt, hält eine historische Rede. Hunderttausende haben stundenlang auf seine Worte gewartet. Den Moment aber nehmen sie dann doch nur durch den kleinen Bildschirm in ihrer Hand wahr.
Statt Geschichte hautnah zu erleben, ihr zuzuschauen, filmen sie etwas, das sie später kaum mehr anschauen.
Rasch leert sich nach der Vereidigung die National Mall in Washington. Den einen zeigt das Smartphone den Weg zur Metro. Andere bestellen damit bei Uber einen Wagen. Wer will, kann Trumps Rede nochmals auf Youtube sehen. Auf Instagram sind die besten Fotos des Tages zu sehen, auf News Apps ist in jeder Sprache eine Einschätzung zum Auftritt des neuen Präsidenten zu lesen. Per WhatsApp wollen Kollegen aus der Redaktion in Zürich wissen, wann der Text kommt, der gerade auf dem iPhone entsteht. Noch im Uber-Auto übermittle ich per WeTransfer Videos nach Zürich.
Kaffee und Kuchen am Nachmittag zahlt eine App. Später, nach Feierabend, findet das Telefon ein passendes Restaurant, kauft Tickets fürs Kino. Es ermöglicht den Videochat mit der Familie. Andere finden am selben Abend damit kurzzeitig etwas körperliche Nähe.
Das Gerät misst Schritte, zählt Kalorien, zeigt die Zeit, das Wetter, die Kurse von Aktien. Es übersetzt, nimmt Töne auf, bearbeitet Fotos. Es klingelt, surrt, macht Musik, ist Büro und Bibliothek, Agenda und Kiosk. Alles, was ein Reporter erledigen muss, kann er damit erledigen. Ach ja, es telefoniert sogar.
Kein anderer Begleiter steht uns näher. Stillt Sucht und ersetzt Sex. Es ist das Letzte, was wir nachts loslassen, das Erste, das wir morgens berühren. In Restaurants liegen beim Dinner zu zweit zwei davon auf dem Tisch. Ist das Essen bestellt, greifen beide zum Gerät. Sie schreibt, er liest, oder umgekehrt. Ist der Salat verzehrt, tauschen sie Gabel wieder mit Telefon.
Deutschland kürte 2015 «Smombie» zum Jugendwort des Jahres. Ein Wortkoffer aus «Smartphone» und «Zombie». Es beschreibt Menschen, die ständig aufs Handy starren und wie lebende Tote durch die Gegend ziehen, ohne ihre Umgebung wahrzunehmen. In China redet man von «dai tau juk» – vom Stamm der Kopf-Runter-Menschen. Die «Generation Kopf unten» starrt nonstop auf elektronische Geräte, beim Gehen, beim Liegen, beim Sitzen, auf dem Velo, beim Autofahren. Über ein Viertel der Verkehrsunfälle in den USA, hat der Nation Safety Council berechnet, werde von Fahrern am Handy verursacht.
Zehn Jahre ist es her, seit der damalige Apple-Chef Steve Jobs (1955– 2011) das iPhone vorstellte. Ein einziges Gerät, das drei Dinge sein würde: ein iPod, ein Telefon und eine Auffahrt ins Internet.
Was für eine Untertreibung. Heute erledigt es fast alles.
Das iPhone – und seine Nachahmer – hat das Leben der Menschen verändert. Katapultiert, umgekippt, abrupt gestoppt, extrem beschleunigt.
Ähnlich wie zuvor das Feuer, das Rad, der Buchdruck, die Dampfmaschine, die Fliegerei.
Seit dem Abwurf von zwei Atombomben über Japan hat keine Technologie das Wesen der Welt so sehr verändert.
Heute ist normal, was absurd ist. Auf der Toilette Tweets zu lesen, auf dem Skilift mit Menschen in der Wüste zu chatten. Mütter streicheln ihr iPhone, während ihr Baby im Sand krabbelt. Aus weissen Stöpseln rieseln beim Velofahren globale Podcasts. Eltern schelten Kinder, sie würden nur gamen und SMS schicken, statt mit ihnen zu reden. Nur, um dann selbst zu gamen und SMS zu schicken.
Neue Geschäftsfelder und Berufe brachte das iPhone hervor, alte verschwanden. Heute gibt es App-Entwickler. Vor zehn Jahren gehörten Banken und Energie-Konzerne zu den grössten Unternehmen der Welt. Heute sind es vornehmlich Technologie-Konzerne, die dank Smart-phones riesig geworden sind: Apple, Facebook, Alphabet, China Mobile.
Ein Medienunternehmen ohne mobiles Angebot? Nicht relevant!
Das Smartphone hat uns fest im Griff. Rund 2600-mal pro Tag berühren wir es im Schnitt. Täglich verbringen wir fünf Stunden damit, so eine britische Studie. Das ist ein Drittel der wachen Zeit und doppelt so lange wie viele glauben.
Doch was macht das mit uns? Wenn wir gleichzeitig dort und dort und überall sind? Wir an Sitzungen teilnehmen und der Freundin mitteilen, welcher Film wann läuft? Wenn nichts mehr hier und jetzt passiert? Sondern immer woanders auf dem Touchscreen.
Nichts beeinträchtigt die Psyche mehr als das kluge Telefon in der Hosentasche, sagt der amerikanische Gehirnforscher Gary Small. «Es verändert uns radikal.» Solange der Akku reicht, fliessen Töne, Texte, Fotos und Videos aus dem Smartphone ins Gehirn.
Nonstop.
Das, so Small, verändert unser Denken. Pausen haben den Menschen geholfen, Erlebtes zu verarbeiten, Gedanken zu speichern, daraus Wissen zu formen. Wer nur aufnimmt, nie ausruht, lernt nichts und vergisst. «Weil alle Informationen ständig abrufbereit sind, bemühen wir uns nicht mehr, uns etwas zu merken», so der Chef-Psychiater der Stanford University, Elias Aboujaoude.
Wissenschaftler wie er belegen: das Smartphone macht ungeduldiger, impulsiver, narzisstischer, es raubt uns Empathie. Die innere Nervosität steigt. Die Fähigkeit, nonverbale Zeichen zu deuten, schwindet. «Wer nur über Bildschirme in Kontakt mit anderen ist, kann Körpersprache nicht mehr interpretieren», sagt Gehirnforscher Small. Dabei habe sich das menschliche Gehirn durch den Austausch von Angesicht zu Angesicht entwickelt. «Nun verlieren wir die Fähigkeit, menschliche Zeichen zu lesen.»
Schaden nehme die Effizienz. «Wer die Umgebung immer absucht nach Stimulanz, leistet wenig – es ist wie ein Auto, das ständig anfährt und sofort wieder stoppt.»
Mit Folgen. «Sind wir immer verbunden, entfällt die Ruhezeit», sagt Small. «Um kreativ zu sein, müssen wir Tagträumen.» Da uns dies abhanden gehe, «wird die Gesellschaft zunehmend autistischer».
Weil wir nicht allein sein können, hängen wir ständig am iPhone, argumentiert Sherry Turkle in ihrem Buch «Alone Together» – «verbunden, aber doch alleine». Turkle ist Soziologieprofessorin am Massachusetts Institute of Technology in Boston. «Diese kleinen Geräte sind psychologisch so mächtig, dass sie nicht nur verändern, was wir tun, sondern wer wir sind.»
Das Smartphone gibt vielen Halt. Ein echtes Gespräch kann entgleiten, da fehlen manchmal die Worte. Oder es fallen Worte, die man nicht zurücknehmen kann.
Nicht so beim digitalen Austausch. Da hat man scheinbar alles im Griff. «Dank dem Mobiltelefon sind wir mit anderen zusammen, haben aber doch die totale Kontrolle», so Turkle. «Echte Beziehungen sind dreckig, sie verlangen etwas von den Beteiligten. Technologie säubert sie.»
Geräte wie das iPhone helfen in Bereichen des Alltags, wo wir besonders verletzlich sind. Sie bieten total kontrollierbare Beziehungen. «Jeder hat Angst vor Einsamkeit und Intimität», sagt Professorin Turkle. «Ein Smartphone gibt uns die Illusion von ständiger Gesellschaft, ohne die Bürde echter Freundschaften.»
Drei Illusionen kreiere das Gerät:
• dass wir für das aufmerksam sein können, was wir gerade wollen;
• dass uns immer jemand zuhört, deshalb publizieren wir auf Twitter, Facebook und Instagram;
• dass wir nie allein sein müssen.
Vor allem Letzteres verändere unsere Psyche. Wer heute allein ist, greift sofort zum Gerät, weil er das Alleinsein nicht aushält. Dabei wäre es wichtig, sich der Einsamkeit hinzugeben, sagt Turkle: «Erst, wenn wir nicht mehr fähig sind, allein zu sein, werden wir richtig einsam.»
Falsche Geborgenheit aber verbiege die Psyche. Merken wir, dass nur ein digitales Wesen auf uns aufmerksam ist, fallen wir in Trauer.
Wir geben Kindern ein iPhone in die Hand, wenn es nervös ist, um es zu beruhigen. Und wir erreichen damit genau das Gegenteil, sagt Sherry Turkle. «Sich in Solitüde zu finden und allein sein ist der Grundstock für die Entwicklung», sagt Turkle. «Die Kinder sollten das nicht verpassen, weil sie durch einen Device befriedigt werden.»
Untersucht hat Turkle, wie Kinder auf Eltern reagieren, die oft am Telefon herumfummeln. Ihre erschreckenden Ergebnisse: Die Kleinen unterdrücken Gefühle, wenn Mama und Papa das Telefon in der Hand halten. Die traurige Tochter weint nicht, wenn die Mutter sie mit dem iPhone am Ohr von der Schule abholt. Der fröhliche Sohn lacht nicht, wenn der Vater tippt.
Sie wissen: Der kleine Bildschirm ist die grosse Mauer zur Welt. Liegt das Telefon in der Hand, ist alles
andere unwichtig. «Bin gleich bei dir, nur noch ganz kurz», sagt der Vater zum Kind auf der Rutschbahn – und tippt weiter. Wie der Alkoholiker und sein ewig letzter Drink.
Dann ist es eine Sucht? Zumindest fühlen sich Menschen, die ihr Gerät zu Hause vergessen, rasch gestresst. Lassen sie es liegen, empfinden sie Trennungsängste.
Ähnlich wie bei Heroin- und Nikotinsüchtigen fliesst bei iPhone-Nutzern das Glückshormon Dopamin. Aktiv sind vor allem jene Zonen im Hirn, die bei Gefühlen ansprechen, als handle es sich beim Smartphone um einen Freund, ein Familienmitglied, den Lover.
Als sei es Liebe. Den Geliebten gibt es in verschiedenen Farben und mit bis zu 256 Gigabyte Speicher.