Von Peter Hossli (Text) und Pascal Mora (Fotos)
Noch ist es ruhig am Bahnhof Tabanovtse an der mazedonisch-serbischen Grenze. Händler bringen in Schubkarren Wasser und Kekse. «In zehn Minuten kommt der Zug», sagt einer. Er weiss es, weil ein Informant von ihm im Zug ist. Kurz vor halb zehn heult die Pfeife der Lokomotive. Ein junger Mann steckt den Kopf aus einem verrosteten Waggon. «Are we here?», ruft er. «Sind wir hier?» – «Ja», sagt ein Polizist. «Los, alle aussteigen!»
Hunderte von Menschen strömen auf den Bahnsteig, darunter Kinder und gebrechliche Alte.

Der lange Marsch – syrische Flüchtlinge auf dem Weg von Mazedonien nach Serbien.
Der lange Marsch – syrische Flüchtlinge auf dem Weg von Mazedonien nach Serbien.

Flüchtlinge steigen beim Bahnhof Tabanovtse aus dem Zug.
Flüchtlinge steigen beim Bahnhof Tabanovtse aus dem Zug.

Ankunft der Flüchtlinge beim Bahnhof Tabanovtse in Mazedonien.
Ankunft der Flüchtlinge beim Bahnhof Tabanovtse in Mazedonien.

Die meisten Flüchtlinge kommen aus Syrien, andere aus Afghanistan und Irak.
Die meisten Flüchtlinge kommen aus Syrien, andere aus Afghanistan und Irak.

Flüchtlinge waschen sich nach der Ankunft beim Bahnhof Tabanovtse in Mazedonien.
Flüchtlinge waschen sich nach der Ankunft beim Bahnhof Tabanovtse in Mazedonien.

Freiwillige verteilen beim Bahnhof Tabanovtse Schuhe an Flüchtlinge.
Freiwillige verteilen beim Bahnhof Tabanovtse Schuhe an Flüchtlinge.

Sein syrischer Flüchtling macht beim Grenzübertritt nach Serbien ein Selfie.
Sein syrischer Flüchtling macht beim Grenzübertritt nach Serbien ein Selfie.

Eine 80-jährige Frau aus Syrien auf der Flucht nach Europa.
Eine 80-jährige Frau aus Syrien auf der Flucht nach Europa.

Die Englischlehrerin Ruba, ihr Mann und Sohn Jade.
Die Englischlehrerin Ruba, ihr Mann und Sohn Jade.

In Preshova in Serbien müssen sich die Flüchtlinge registrieren lassen.
In Preshova in Serbien müssen sich die Flüchtlinge registrieren lassen.
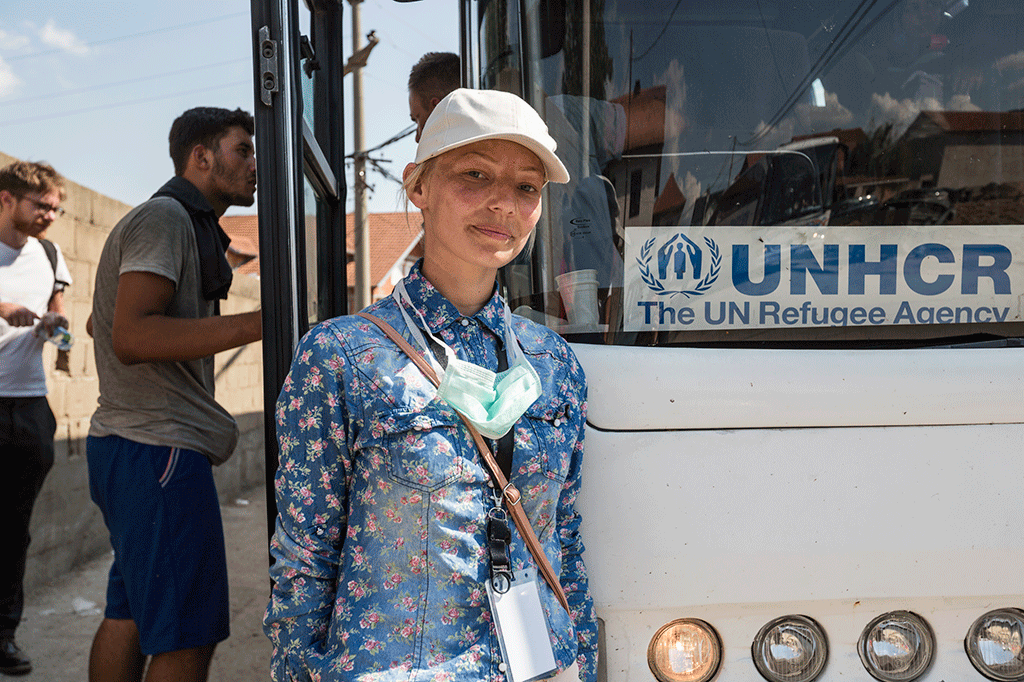
Die Freiwillige Safina hilft Flüchtlingen, Busse zu besteigen.
Die Freiwillige Safina hilft Flüchtlingen, Busse zu besteigen.

Der 26-jährige Ingenieur Suhaib Alghazal ist aus Aleppo geflohen.
Der 26-jährige Ingenieur Suhaib Alghazal ist aus Aleppo geflohen.

Der Kioskverkäufer Bobbi in Preshova konnte seinen Umsatz verzehnfachen. Er verkauft an Flüchtlinge.
Der Kioskverkäufer Bobbi in Preshova konnte seinen Umsatz verzehnfachen. Er verkauft an Flüchtlinge.

Busse stehen in Preshova bereit, um Flüchtlinge nach Belgrad zu bringen.
Busse stehen in Preshova bereit, um Flüchtlinge nach Belgrad zu bringen.
Die meisten sind in Syrien aufgebrochen, andere in Afghanistan und im Irak. Auf der Balkanroute reisen sie nach Europa. In der Türkei bestiegen sie Boote nach Griechenland, sind nun in Mazedonien, bald in Serbien.
Seit zwei Jahren ist Anas El Zein (15) unterwegs. Mit seinem Vater floh er aus Aleppo, «weg von den Isis-Terroristen», sagt er. «Sie haben unsere Stadt total zerstört.» Er arbeitete in Istanbul, bis er genug Geld hatte für den Schlepper. Dreimal bestieg er an der Ägäis ein Boot, dreimal fing ihn die türkische Küstenwache ab. Vor einer Woche klappte es. «Jetzt ist der Weg frei nach Deutschland», sagt Anas. Und die Schweiz? «Dort ist es viel zu teuer.» Er sei pleite. Sein ganzes Geld hat jetzt der Schlepper.
Fünfzehn Minuten dürfen sich Flüchtlinge auf dem Bahnhof aufhalten, so will es die mazedonische Regierung. «Wo ist Serbien?», fragt Anas den Polizisten. Der streckt den Arm aus, zeigt nach Norden. «Vier Kilometer, eine Stunde zu Fuss.»
Auf dem Platz neben den Gleisen waschen sich Männer den Schweiss vom Gesicht, Frauen erhalten neue Schuhe. Jeder scheint in Eile, alle wollen weiter. Sie tragen Zelte, stossen Babys in Kinderwagen, eine 80-jährige Frau geht an Krücken. Sind sind auf dem langen Marsch der Hoffnung nach Europa. Das Bild gemahnt an den Balkan während der 90er-Jahre, als hier 800 000 flohen.

Die Sonne brennt, sie keucht. «Noch zehn Minuten», sagt ein bewaffneter serbischer Soldat, der am Wegrand steht. Wie schafft Ruba die Strapazen der Flucht? «Das überlege ich mir gar nicht, als Mutter mache ich alles für meine Kinder.»
Der Marsch ist mühselig. Viele suchen Schatten unter Bäumen. Leere Flaschen und unzählige Säcke säumen den Weg. Ahmed (35) aus Idlib hilft seiner Frau und fünf Kindern über einen Bach, zuletzt trägt er einen Kinderwagen mitsamt Baby. «Haben Sie Zeit für ein Interview?» – «Was bringt mir ein Interview?», fragt er zurück. «Ich brauche ein Auto, das meine Familie nach Berlin fährt!»
Endlich, Ruba erreicht die blauen Zelte der serbischen Armee. Panzerwagen stehen auf einem Hügel, Soldaten wachen. Ein Serbe gibt den Flüchtlingen arabische Anweisungen, die serbische Regierung bemüht sich.
Für viele Serben aber ist der lange Marsch ein grosses Geschäft. Taxis, welche Flüchtlinge ins nächste Dorf karren, verlangen zehnmal mehr als sonst. Von morgens bis abends ist Burim (32) unterwegs. Fotografieren lassen will er sich nicht. «Die Presse zerstört das Geschäft», sagt er und jagt die Reporter weg. Niemand soll wissen, wie er mit dem Elend Geld verdient. Viele können sich das Taxi nicht leisten, sie marschieren eine halbe Stunde zu den Bussen von Dafina (24). Sie gilt als Engel von Miratovac. Ihre blauen Augen leuchten, sie strahlt. Seit zwei Wochen füllt sie Busse, die das Uno-Flüchtlingswerk UNHCR stellt, hilft täglich 2000 Menschen. «Manchmal sind es 10 000», sagt sie. Sie helfe, «weil wir vor kurzem in einer ähnlichen Situation waren», so Dafina, «damals, als hier der Bürgerkrieg tobte und jeder um sein Leben rannte».
Die Busse, die Dafina füllt, halten im Zentrum von Preshevo, einer serbischen Stadt mit albanischer Mehrheit. Stundenlang warten die Flüchtlinge vor einem Militärzelt. Hier müssen sie sich registrieren, lassen sich fotografieren, geben Fingerabdrücke, erhalten einen Pass. Damit können sie sich 72 Stunden frei in Serbien bewegen, es sei denn, sie bitten um Asyl. «99 Prozent wollen weiter», sagt ein Polizist.

Saudi-Arabien. Er will nach Deutschland. In der Schweiz, hat er gehört, «ist es viel zu kalt».
Er grinst, scheint überdreht. «Ich bin einfach nur müde», sagt er. «Es ist, als schlafe ich nie.» Viel hat er nicht mehr: ein paar kurze Hosen, etwas zu essen, ein Zelt und ein Smartphone. Der Akku ist seit Tagen leer.
Gegen einen Euro kann er es in einem Geschäft in Preshevo aufladen. Etwa bei Bobbi (34). Er betreibt einen Kiosk mitten in Preshevo, verkauft auf sechs Quadratmetern Fläche Wasser, Zigaretten, Seife und Schokolade. «Seit zwei Monaten ist der Teufel los», sagt Bobbi. «Es ist verrückt.» Fast rund um die Uhr hat er geöffnet. Verzehnfacht habe er seinen Umsatz. Sein Hit? «Wasser und Zigaretten.»
Sheila (18) stellt sich in die Schlange, um Reisepapiere abzuholen. Ihr Haar hat sie unter einem Kopftuch versteckt, ihre dunklen Augen leuchten. Sie hat Aleppo vor einem Monat verlassen. Ihr Schiff von Bodrum nach Kos kenterte. «Die Griechen haben uns das Leben gerettet», sagt sie. «Klar, diese Flucht ist sehr hart.» Sie blickt den Reporter an: «Sagen Sie Ihren Lesern, wir lieben Syrien, wir wollen zurück. Helft uns, diesen Krieg endlich zu beenden!»





