Von Peter Hossli (Text) und Katarina Premfors (Fotos)

Seit 18 Monaten lebt Budalama in Katar, dem Emirat am Persischen Golf. Er ist Gastarbeiter, wie die sieben Nepali, mit denen er das karge Zimmer teilt. Vier Stockbetten stehen auf dem Boden, belegt mit dünnen, zerrissenen Matratzen. Ein Horrorfilm läuft am Fernseher.
Weil es regnet, faulenzen sie. Sonst schuften die acht Nepali auf der weltweit grössten Baustelle. Bis zur Fussball-WM 2022 entstehen in Katar Bauten für rund 225 Milliarden Franken – Stadien, Schienen und Strassen, Shopping-Malls und Wolkenkratzer. Daran verdienen Baukonzerne aus China, Saudi-Arabien und aus Europa.
Kärglich verdienen die Nepali – zwischen 1000 und 2000 Katar-Riyal im Monat. Das sind 250 bis 500 Franken. Wobei das Leben in Katar mehr kostet als in der Schweiz, ein Maurer in Biel oder Genf aber bis 7000 Franken erhält.
Budalama (25) mag keinen Fussball. Obwohl die WM über Jahre hinaus seine Stelle sichern würde, will er weg. «Das Klima hier ist mörderisch.» Bis 50 Grad heiss ist es im Sommer in Doha. Gleichwohl stehen Kranen und Betonmischer selten still. Oft sah Budalama, wie Arbeiter vor ihm mit einem Sonnenstich zusammenbrachen.

Für «ein eigenes Geschäft in Nepal» spart Budalama. Stets pünktlich erhält er Lohn – und kann sich glücklich schätzen. Monatelang warten Arbeiter hier oft auf ihr Salär, belegen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch. Ausreisen können sie nur, wenn sie auf ihre Ansprüche verzichten.
Jeden Tag sterben in Katar zwei Menschen auf dem Bau, sagt die International Trade Union Confederation. Bis zum Anpfiff der WM 2022 gäbe es 4000 Tote. Nicht nur die Hitze töte. Unfälle sind alltäglich, Selbstmorde häufen sich.
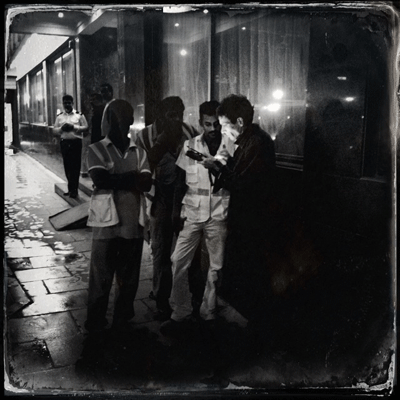
Lang schwieg dazu Fifa-Präsident Sepp Blatter. Oder er sagte, die Verantwortung liege bei den Baufirmen, die jetzt erstellten Bauten hätte nichts mit der WM zu tun.
Amnesty sieht das anders: «Die Fifa muss dafür sorgen, dass Menschenrechte bei allen Bauten respektiert werden, nicht nur bei Stadien», sagt Sprecher Elsayed Ali zu SonntagsBlick. Er von der Fifa verlangt Druck auf Katars Regierung. «Die Fifa ist natürlich besorgt über die Zustände in Katar», beantwortet Blatter schriftliche Fragen von SonntagsBlick. «Katar muss sich diesem Problem annehmen».
Es sei «ermutigend, dass die Fifa endlich die Rolle akzeptiert, die Situation der Arbeiter zu verbessern», sagt Ali von Amnesty. Aber: «Sie muss dringlicher vorgehen.»
Für Blatter ist all das ein diplomatischer Seiltanz. Der Katholik will die WM nicht auf dem Buckel von Leibeigenen durchführen. Allzu laut kritisieren kann er nicht.

Die Al-Thanis sind eine der reichsten Familien der Welt. Über 100 Milliarden Dollar hat ihr Staatsfonds im Ausland investiert. Etwa in die Credit Suisse, den Flughafen Heathrow in London, den Fussballklub Paris St-Germain.
Heute zählt Katar 200000 Bürger. 94 Prozent aller Arbeitsplätze belegen Ausländer. Die meisten stammen aus Nepal, Indien und Bangladesch. Sie putzen, kochen, servieren, unterrichten, fahren Taxi, fördern Öl und Gas, hämmern und nageln. Ihre Aufgabe: für Katar eine Grundlage zu schaffen für die Zeit nach dem Öl und dem Gas. Die Fussball-WM ist dabei Teil eines grossen Plans. Eine Tourismus- und Shoppingdestination soll Katar künftig sein, ein Ort, wo Diplomaten verhandeln, Akademiker forschen, voller Konsum die Wirtschaft ankurbelt.
Der Bedarf nach Arbeitern ist riesig. Stündlich wächst die Bevölkerung in Katar um 20 Personen.
Gemächlich zuckelt der Verkehr auf den verstopften Strassen durch Doha. Wind wirbelt Wüstensand auf. Maschinen reissen alte Quartiere nieder, bauen neue auf.

Die Fahrt durch Doha dauert eine Stunde, bis in die Industriezone am Stadtrand. Hier stehen «Labor Camps», dürftige Unterkünfte aus Kunststoff. Zu zwölft hausen Männer in einem Zimmer. Abfall türmt sich. Toiletten quellen über. Die Klimaanlage ist defekt – dabei sinken die Temperaturen im Sommer nachts nie unter 30 Grad.
Wer hier lebt, hat oft Schulden. Die ersten Löhne vieler Arbeiten kassieren Stellenvermittler in Nepal. Wechseln dürfen die Arbeiter den Job nur, wenn der Boss es zulässt. Eine schriftliche Bewilligung ist nötig, um ein Bankkonto zu eröffnen oder einen Führerschein zu erwerben. Um das Land zu verlassen, braucht es ein Exit-Visa, unterschrieben vom Innenministerium.
Dieses Kafala genannte System sei «moderne Leibeigenschaft», klagt Amnesty International. Quittiert etwa Budalama die Stelle vorzeitig, wird er verhaftet und ausgeschafft. Lohnansprüche verfallen.
Sich zu wehren, ist teuer. Gerichte verlangen 600 Katar-Riyal, um eine Klage weiterzureichen, rund 150 Franken – unzahlbar für jemanden, der zehn Monate keinen Lohn erhält. Zwar ist Sklaverei in Katar illegal, das Strafmass ist
aber milde: sechs Monate Haft. Ein «offenes Gefängnis» sei Katar, sagte Nepals Botschafterin in der BBC.
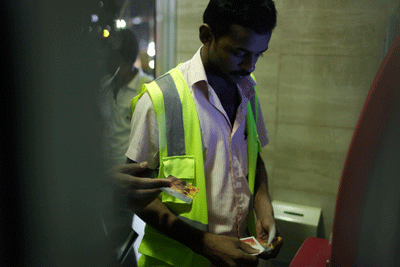
Seit drei Jahren lebt der Inder Rajan, 26, in Katar. Heute ist Zahltag. Er stellt sich in die lange Schlange vor den Bankautomaten bei der Baustelle, hebt 1000 Riyal ab, die Hälfte des Lohns. Genehmigt er sich einen Drink? «Nein, ich schicke alles heim.» Sicher, sagt er, «Katar ist hart, aber so sichere ich meiner Familie ein gutes Leben».
