Von Peter Hossli (Text) und Robert Huber (Fotos)

Als er gerade den Dienst begonnen hat, nähert sich seinem Wachhäuschen eine Edelkarosse. Trinkoff hat das Auto noch nie gesehen. Er hebt die Hand, der Wagen stoppt. Mit freundlicher Strenge fragt er den Fahrer nach Namen und Ziel, wirft dann einen Blick auf seinen Bildschirm und sagt schliesslich: «In Ordnung, Sir, Sie können passieren.» Die Barriere surrt nach oben, der Weg zur Luxuswohnanlage «The Pines» in Boca Raton in Florida ist frei. «Ich beschütze die, die hier wohnen – und deren Eigenheim.» Er tönt, als habe er eine Mission. In Wirklichkeit macht er seinen Job, um zu überleben.
Trinkoff dreht das Transistorradio etwas lauter, die Wettervorhersage prophezeit auch für diesen Tag 27 Grad im Sonnenstaat Amerikas. Vor zehn Jahren zog Trinkoff mit seiner Frau vom frostigen Brooklyn ins milde Florida. Hier wollte der pensionierte Buchhalter seine letzten Jahre geniessen. Doch die Altersvorsorge, in die er 40 Jahre einbezahlt hatte, reicht nicht. Die Wohnung, die er sich gekauft hat, ist noch lange nicht schuldenfrei. Und zu hoch sind die Kosten für die Pillen, die sein Nierenleiden mildern sollen. Als seine Gattin vor zwei Jahren starb, halbierte sich auch der Sozialversicherungszuschuss. Heute sagt Trinkoff: «Ich werde arbeiten, bis ich sterbe.»
«Ich verlasse den Posten nie»
Er klingt nicht bitter. Glücklicherweise gebe es keine Altersbeschränkungen für Wachpersonal, erklärt der rüstige Rentner. Einen Vertrag hat er zwar nicht, also kann ihm sein Chef jederzeit kündigen. Trotzdem sorgt sich Schutzmann Trinkoff nicht. «Ich bin zuverlässig, das schätzt mein Chef. Ich komme nicht zu spät, verlasse den Posten nie und lasse niemanden rein, der hier nicht reingehört.» Fünfmal pro Woche schiebt der alte Mann Wache, jeweils von 16 Uhr bis Mitternacht. Für 7.50 Dollar die Stunde.
Ein Heer von Pensionären krümmt im amerikanischen Rentnerparadies Florida den Rücken. In Broward County nördlich von Miami, wo die feinen Orte Fort Lauderdale und Boca Raton liegen, leben 350 000 Senioren – zehn Prozent davon in «extremer Armut», wie die Area Agency on Aging festgestellt hat. Diese staatlich finanzierte Behörde hilft bedürftigen Alten, versorgt sie mit Mahlzeiten und verschafft ihnen subventionierte Wohnungen. Ein Drittel der Alten, so das amtliche Fazit, habe «zwar genug zum Überleben, aber zu wenig zum Leben».
Also schuften die Rentner als Packer im Supermarkt, als Hotelportier oder Bedienung. Ein bizarres Bild: Reiche Alte, die in Seniorenanlagen wie «The Pines» ihren Lebensabend mit Golf, Sonnen oder Bingospielen verbringen, werden von armen Alten wie Wachmann Trinkoff umsorgt.
Betroffen sind nicht nur Minderheiten wie Schwarze oder Lateinamerikaner. Altersarmut ist zu einem Problem der weissen Mittelklasse geworden. Der Einbruch an der Wallstreet hat die Renten reduziert – oder sogar ausgelöscht. Die Situation sei «ernüchternd», heisst es in einem Bericht des Seniorenverbands AARP, der 35 Millionen Mitglieder zählt. Die Kursverluste an den Börsen zwingen viele Betagte, «trotz Ruhestand wieder zu arbeiten, die Pensionierung zu verschieben oder ihren Lebensstil zu ändern».
Ihnen versucht Tom Mulligan zu helfen. Der etwas untersetzte AARP-Angestellte leitet in Fort Lauderdale eines von landesweit 90 Arbeitsvermittlungsbüros für Senioren. Das Telefon klingelt ständig. Am Draht sind Alte, die sich auf die lange Warteliste für die wenigen freien Stellen setzen lassen möchten. Mulligan nimmt nicht jeden. Gemäss Gesetz können nur jene einen dieser Jobs ergattern, die älter als 55 Jahre sind und unter der Armutsgrenze leben. Die ist in den USA tief angesetzt. Als arm gilt offiziell erst, wer jährlich weniger als 8980 Dollar verdient. Ein zweiköpfiger Haushalt wird als hilfsbedürftig eingestuft, wenn das gemeinsame Einkommen 12 120 Dollar im Jahr nicht übersteigt. Derzeit zählen die USA 35 Millionen Arme – das sind zwölf Prozent der Bevölkerung. Von den Senioren leidet jeder Zehnte unter extremer Armut.
Oft sind es Frauen, die ein Leben lang im Haushalt wirkten, nichts verdienten und deren Rente sich halbierte, als der Ehemann starb. Ihnen vermittelt Mulligan Ausbildungsplätze und Teilzeitjobs für 20 Stunden die Woche. Den Minimallohn – 5.15 Dollar stündlich – bezahlt der Staat. Spätestens nach sechs Monaten soll die betagte Nachwuchskraft im Privatsektor unterkommen, damit der Platz für den Nächsten frei wird.
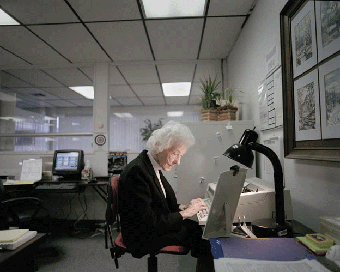
Es sind diese Kosten, die viele Alte in die Armut treiben. Amerikaner zahlen bis zu 80 Prozent mehr für Arzneien als Europäer – ein Problem, das gar zum Wahlkampfstoff taugt. Letzte Woche verwies John Kerry in seiner Rede am Parteitag in Boston mehrmals auf die schlechte Lage der alten Amerikaner. Als Präsident, sagte der Herausforderer von George W. Bush, werde er «sicherstellen, dass ältere Bürger nie mehr ihre Pillen halbieren müssen, weil sie sich die lebensrettende Medizin nicht leisten können.» Die Republikaner würden den Senioren billige rezeptpflichtige Medikamente verwehren, sagte Kerry, und er versprach einen Angriff auf die US-Pharmakartelle: Sollte er gewählt werden, werde er es zulassen, dass alle Amerikaner ihre Medikamente in Kanada kaufen können. Dort sind sie zwischen 40 und 80 Prozent billiger.
«Günstig und zuverlässig»
Die Gesundheitskosten zwingen viele Rentner, ihr Haus zu verkaufen. Der Erlös reicht oft gerade, um die Kredite abzuzahlen, mit denen das Eigenheim belastet ist. Und so fliesst zwar Geld für die nötigen Medikamente, dafür ist der Patient obdachlos. Und er muss zurück in den Arbeitsmarkt.
Neben den vielen illegalen Einwanderern, die beinahe gratis arbeiten, sind die Oldies willkommene Arbeitnehmer. «Alte sind günstig und zuverlässig», sagt Desmond Lerner, ein kräftiger Mann, dessen graues Haar militärisch kurz geschnitten ist. Seit Jahren betreibt Lerner eine Schule für Sicherheitspersonal. Sein Geschäft boomt seit dem 11. September 2001. Jeder Fünfte seiner jährlich 2000 Schulabgänger ist Senior. «Es sind meine besten Schüler», sagt Lerner. Sie hätten oft eine bessere Einstellung zum Job als die Jungen, «sie bereiten sich auf ihren Einsatz vor, gehen vor der Arbeit pinkeln und kommen nie spät.»

Seit einem Jahr arbeitet Racz bei Publix, einer Supermarktkette, die Alte gezielt fördert. «Sie machen weniger Fehler als die Jungen», sagt eine Publix-Sprecherin. An Racz’ dicken Fingern sind Schwielen zu sehen. Er versucht, nicht auf seine schmerzenden Hände zu achten. An diesem Tag hat er noch vier Stunden Arbeit vor sich. Doch selbst wenn er viele weitere Jahre bei Publix jobben würde: Seinen Schuldenberg wird er nie mehr abzahlen können.
Eine unschön verwachsene Narbe, die fast bis zum Halsansatz reicht, erinnert ihn jeden Tag daran. Sie ist Zeugnis eines dreifachen Herzinfarkts. Da er wie fast die Hälfte aller Amerikaner nicht krankenversichert war, summierten sich 75 000 Dollar für ärztliche Eingriffe. Längst hat er sein Erspartes aufgebraucht, nur 618 Dollar bekommt er monatlich von der Sozialversicherung. Obwohl er 45 Jahre lang einzahlte.
Die Doktoren werden also auf ihr Geld warten müssen. Fast täglich rufen Inkassobüros an, die Ärzte auf ihn angesetzt haben. Doch meist läuft Racz’ Anrufbeantworter, denn an freien Tagen liegt der alte Mann den ganzen Tag im Bett. «Ich erhole mich von der Arbeit, damit ich wieder arbeiten kann. Ich kann es mir nicht leisten, nur einen einzigen Tag zu fehlen.»
Jeden Morgen um 4.30 Uhr steht Ella Yontz, 75, auf. Bevor sie aus dem Haus geht, frisiert sie ihr golden gefärbtes Haar sorgfältig und trägt Lippenstift auf. Seit 30 Jahren serviert sie im «Oceanside», einem düsteren Schnellrestaurant an der Route A 1A, die von Miami bis in den Norden Floridas dem Atlantik entlang führt. Um halb sechs kommen die ersten Gäste zum Frühstück. Ella Yontz kreist wendig um die acht Tische, nimmt Bestellungen auf, giesst Kaffee nach, bringt die üppig mit Schinken, Eiern und Butter-Toast beladenen Teller aus der Küche.
Sie arbeitet fünfmal pro Woche. Zehn Stunden. Ohne Pause. Ohne festes Gehalt. Denn das Servicepersonal erhält keinen Lohn, nur das Trinkgeld darf es behalten. An einem guten Wintertag, wenn Touristen das Lokal füllen, verdient Yontz um die 70 Dollar. Im Sommer, wenn sich unerträgliche Hitze über den Sonnenstaat legt und vor allem knausrige Einheimische oder arme Rentner hier essen, sind es selten mehr als 30 Dollar. Selbst darauf muss sie bald verzichten, demnächst schliesst das «Oceanside». Teure Altenresidenzen mit Luxusboutiquen sollen hier entstehen.
Auf die Hilfe ihrer drei Kinder kann sie nicht zählen. Die sind selber in den Miesen – wie der Grossteil der Amerikaner. Durchschnittlich hat jede US-Familie 54 000 Dollar Schulden, mit 8000 Dollar steht ein Haushalt allein bei Kreditkartenfirmen in der Kreide. «Ich glaube nicht an die Erholung der Wirtschaft», sagt Ella Yontz, «obwohl der Präsident dauernd davon spricht.» Sie räumt die leer gegessenen Teller weg und legt frisches Besteck auf den Tisch. «Bush setzt sich doch nur für seine reichen Freunde ein. Die Reichen werden noch reicher, die Armen ärmer.»
Dass zornige Alte das Ergebnis der Präsidentenwahl im November beeinflussen werden, bezweifelt Patricia Robbins. Sie versorgt zwei Millionen Haushalte mit kostenlosen Lebensmitteln. «Wer Hunger hat, hat andere Sorgen, als sich um Politik zu kümmern – und Hunger haben in Florida viele.» 1991 gründete Robbins «Farm Share», ein Programm, das Nahrung an Bedürftige abgibt. Seither hat sie fast 100 Millionen Tonnen Gemüse und Früchte verteilt.
Auf der Bank vor der Lagerhalle stehen die Bedürftigen Schlange. Sie halten einen roten Zettel in der Hand, einen Gutschein, für den sie einmal monatlich kostenloses Essen bekommen. Sie gehen mit Aprikosen, Milch, Kartoffeln, Tomatensauce, Zwiebeln und Pudding nach Hause. 70 Prozent der Klientel von Patricia Robbins sind Senioren. An die Öffentlichkeit gelangt das allerdings selten. «Amerika ist die reichste Nation der Welt», sagt Robbins: «Hier will niemand hören, dass Menschen Hunger haben. Denn dann müssten wir ja etwas dagegen tun.»

jetzt habe ich angst alt zuwerden.