Von Peter Hossli

Dieses Verhältnis zwischen Affe und Wärter wollen Politiker im diesjährigen Wahlkampf um das Wohnrecht im Weissen Haus umdrehen.
Mancher Kandidat steht auf – und stempelt die Medien zum Feind.
Ein «Debakel» schimpfen die republikanischen Präsidentschaftskandidaten ihre eigene TV-Debatte Ende Oktober. Wegen der vermeintlich aggressiven Fragen der Moderatoren.
Der texanische Senator Ted Cruz, 44, etwa verlangt, fortan sollen Moderatoren sagen, ob sie republikanisch wählen würden. Der politisierende Chirurg Ben Carson, 64, will alle Debatten auf Facebook verlegen und sich nur noch von Wählern befragen lassen, nicht aber von Journalisten.

«Donald Trump, sind Sie ein Bösewicht aus einem Comic-Book?» – «Ben Carson, können Sie rechnen?» – «Marco Rubio, warum treten Sie nicht zurück?» – «Jeb Bush, warum sacken Ihre Umfragewerte ab?»
Diese Fragen seien einzig dazu da, die Republikaner landesweit lächerlich zu machen. «Warum befragen Sie uns nicht zu echten Themen?»
Es geht sehr wohl um Substanz bei der Debatte. Und da schneiden die Kandidaten durchwegs schwach ab. Nach der Debatte aber reden alle nur über die Moderatoren. Das wichtigste Thema? Der Rundumschlag von Cruz, sein Frontalangriff auf die Medien. Der Senator Marco Rubio, 44, – Favorit unter den Republikanern – nennt die Medien einen «Super Pac for Hillary», eine Finanzierungs-Organisation für die demokratische Kandidatin Hillary Clinton, 68. Als «lächerlich» straft Donald Trump, 69, die Debatte ab.
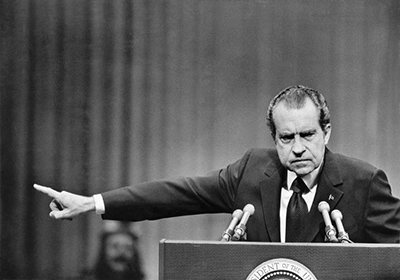
Ironisch daher, dass ausgerechnet die beiden Reporter Bob Woodward, 72, und Carl Bernstein, 71, Nixon mit Journalismus zu Fall brachten. George W. Bush, 69, Präsident von 2001 bis 2009, sagte Journalisten oftmals direkt ins Gesicht, sie würden das Volk nicht repräsentieren.
Die Umfragen anführen
Warum aber beuteln US-Präsidentschaftskandidaten die Medien? In jenem Land, das wie nichts die Pressefreiheit ehrt? Weil sie sich so Gehör verschaffen. Und das erhöht ihre Beliebtheit. Mit jedem Angriff klettern sie in den Umfragen ein paar Prozentpunkte nach oben. Und allein um Umfragewerte geht es, bevor in den Vorwahlen erste Stimmen abgegeben werden. «Nie spielten Umfragen eine grössere Rolle als bei diesen Wahlen», sagt der Statistiker Nate Silver, 37, der auf seiner Website FiveThirtyEight besser als jeder sonst Wahlumfragen interpretiert. «Umfragen beeinflussen Wähler, und Wähler beeinflussen Umfragen.»
Umso lauter schreien Politiker vor den Vorwahlen. Fällt einer auf, führt das zu Suchanfragen auf Google und Einträgen in Newsportalen, so Silver. Suchanfragen wirken sich stärker auf Umfragen aus als Nachrichten in den Medien. Zumal solche Suchen wiederum Medienberichte auslösen – die die Bekanntheit des Politikers fördern. «Hält der Hype um eine Person an, steigen die Umfragewerte», sagt Silver. Das ist der Hauptgrund, warum etwa der aufgedonnerte Milliardär Trump so lange an der Spitze steht. Er sagt Aussergewöhnliches und fordert Unrealistisches. Etwa die Deportation von elf Millionen illegal in den USA lebenden Mexikanern. Oder die Registrierung aller Muslime im Land. Damit bleibt er in den Medien. Sobald der Hype-Zyklus abflacht, dürfte Trump verschwinden.

Das bisherige Motto des medialen Wahlkampfs: Jeder und jede brüstet sich, ein noch grösserer Aussenseiter zu sein. Insbesondere die Insider. Ted Cruz, immerhin Senator, nennt sich «Original-Outsider». Jeb Bush, Bruder und Sohn von ehemaligen US-Präsidenten, sagt, er kenne sich in Washington überhaupt nicht aus. «Wer kann eine grössere Aussenseiterin sein als ich?», fragt Hillary Clinton. Obwohl sie als First Lady acht Jahre im Weissen Haus wohnte, dann Senatorin und zuletzt Aussenministerin von Barack Obama war. Es gibt kaum jemand, der die Mechanik Washington besser versteht als Clinton. Ihre Begründung für den Outsider-Status: Sie wäre die erste Frau in der Geschichte Amerikas, die im Weissen Haus nicht nur wohnt, sondern auch das Sagen hat. Ihre Wahl, will sie sagen, wäre historisch. Wie Obamas Wahl – der erste Schwarze als Präsident jenes Landes, dessen Reichtum auf afrikanischer Sklavenarbeit fusst.
Der Aussenseiter-Mythos geht auf die Wahlen im Jahr 1828 zurück. Damals gab sich Andrew Jackson (1767–1845) in den Medien als Outsider. Im Gegensatz zum sitzenden Präsidenten John Quincy Adams (1767–1848) gehöre er nicht zum Establishment. Prompt gewann Jackson die Wahl.

Kandidaten versprechen stets, sie werden Washington nach der Wahl ändern. Bisher tat es keiner. Oder wie es der ehemalige New Yorker Gouverneur Mario Cuomo (1932–2015) einst sagte: «Unser Wahlkampf ist Poesie. Regieren wir, fallen wir in die Prosa.»
Die Karikatur
Zuvor verfallen viele der Komik. Wer kann, erhascht mediale Aufmerksamkeit durch einen Auftritt bei «Saturday Night Live» (SNL). Die Show macht sich über Mächtige lustig, lässt Komiker in die Rolle von Präsidenten und Senatoren schlüpfen, deren Manieren sie nachahmen. Vor acht Jahren brillierte Tina Fey, 45, mit der Darstellung von Sarah Palin, 51, Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin. Rotzfrech imitierte sie die damalige Gouverneurin von Alaska. Bis Palin selbst in SNL auftrat, zusammen mit Fey. Schelmisch lachte Palin über sich selbst.

Der SNL-Auftritt Trumps missglückt. Er moderiert am 7. November die Show, «die schlechteste des Jahres», so ein TV-Kritiker. Trump kann nicht über sich selbst lachen. Highlight der Sendung ist «Seinfeld»-Erfinder Larry David, 68. Er überzeichnet Clintons demokratischen Widersacher Bernie Sanders, 74, als sozialistischen Kauz. Umwerfend.