Von Peter Hossli und Carole Koch
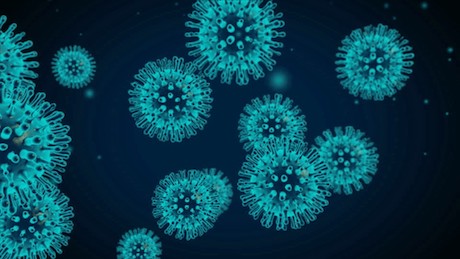
Tage zuvor harrt es noch in einem Tröpfchen. Ein Niesen, ein Husten, und schon fliegt es durch die Luft, zusammen mit Heerscharen von Gleichgesinnten, die in alle Himmelsrichtungen zerstäubt werden. Manche streift die Frühlingssonne, und UV-Strahlen zerstören sie. Andere landen auf Türfallen oder Gartenbänken. Dort lauern sie bis zu drei Tage lang und haben ein einziges Ziel: einen Wirt zu finden und ihn zu überlisten. Gelingt es ihnen nicht, zerfallen sie. Gelingt es, können Menschen sterben.
Es ist ein Kampf um Leben und Tod. Die Evolution hat das Virus dafür gerüstet. Entstanden ist es in China, wahrscheinlich in einer Fledermaus. Ein Schuppentier könnte ihm als Zwischenwirt gedient haben oder ein anderer Säuger. Die Virologen wissen nicht genau, wie es anfing, von einem Tier auf einen Menschen zu springen und dann von Menschen auf Menschen. Sie wissen auch nicht, warum das sogenannte Sars-CoV-2 zehnmal gefährlicher ist als die gewöhnliche Grippe. Oder warum jeder Fünfte schwer an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt, auf der Intensivstation landet oder vielleicht gar stirbt. Aber sie wissen, dieses Virus ist wanderlustig, fies und skrupellos.
Zacken als Geheimwaffe
Sars-CoV-2 stammt aus der Familie der Coronaviren. Seine Verwandten heissen Sars oder Mers und sind mit 120 Nanometern noch kleiner als viele andere Viren. Der Name Corona ist von den Zacken inspiriert, mit denen seine Oberfläche übersät ist und das Virus-Teilchen wie einen kleinen König aussehen lassen. Die Zacken mögen an eine Krone erinnern, sie sind aber viel mehr als das; eine Geheimwaffe, ein Schlüssel zu jenen Zellen, die vor allem in der Nase sitzen, dem Mund, der Lunge oder im Herz-Kreislauf-System. Irgendwo da will es hin, muss es, um nicht zu verenden.
Sein Weg ist voller Hindernisse und die Konkurrenz gross. Zehntausende unterschiedliche Viren versuchen täglich, sich in die Menschen oder Tiere hineinzubohren. Sie sind für die Viren nichts anderes als gigantische Wirtsfestungen, die es zu erobern gilt. Über die Haut? Keine Chance. Die ist für das Coronavirus so unüberwindbar wie ein Betonbunker für Menschen. Auf einem Sandwich-Happen ausharren? Ist nur dann eine gute Idee, wenn es nicht im Magen landet. Dort löst der tiefe und somit saure pH-Wert seine Schutzhülle auf. Gefährdet ist es zudem auf Tischen oder an Fingern, wo ein Tod durch Seife droht.
Der sicherste Weg ist der einfachste. Hinein in Mund, Nase oder Augen, jene Eingänge also, die offen stehen. Besonders leicht geht das, wenn das Virus von einem Finger direkt ans Ziel befördert wird, ein Mensch etwa seine Lippen berührt. Bereits in den Schleimhäuten geht es vielen Viruspartikeln an den Kragen. Die einen sehen, wie die Zacken ihrer Kollegen von Molekülen zerhackt werden. Je näher sie den Zellen in der Mundhöhle oder an den Rachenwänden kommen, desto eher werden sie angegriffen. Da gilt es, rauszukommen beziehungsweise in eine Zelle hinein, so schnell wie möglich.
Vor den Zelltoren tut das Virus so, als käme es in Frieden. Mit seinen Zacken ist es gut getarnt. Als Protein, das an Zellen andockt, um sie mit Stoffen oder Nachrichten zu versorgen. Genau diesen Vorgang imitiert das Coronavirus. Sein Stachel passt so perfekt in den Zellrezeptor wie ein Schlüssel ins Schlüsselloch. Arglos stülpt die Zelle das Virus mit seiner Zellmembran ein und verschlingt es quasi. Endozytose nennt sich dieser Prozess. Normalerweise ist er überlebenswichtig, jetzt aber fatal. Wie fatal, wird sich erst später zeigen. Der Mensch spürt von alldem noch nichts.
Der Trick ist simpel und alt wie die Menschheit selbst. So haben die Griechen in der Mythologie Troja eingenommen. Heute werden jene Computerprogramme als Trojaner bezeichnet, die sich in fremde Systeme hacken wie das Coronavirus in die Wirtszelle. Da muss es höllisch aufpassen, nicht von den Wächtern entdeckt zu werden. Dutzende von ihnen patrouillieren rund um die Uhr in der Zelle, um Eindringlinge aufzuspüren. Das Virus versteckt sich. Es will unbedingt verhindern, dass diese Aufpasser Botenstoffe aussenden, um Nachbarzellen zu warnen und damit eine Kaskade von Alarmsignalen auszulösen. Je länger ihm das gelingt, desto später wird der antivirale Status eingeleitet und der ganze Körper in einen Alarmzustand versetzt. «Achtung, Achtung, hier stimmt etwas nicht, seid alle auf das Schlimmste gefasst.»
Noch ist es nicht so weit. Noch muss das Virus weder gegen Fresszellen, noch Antikörper kämpfen. Es kann in Ruhe arbeiten. Mit seinem Genom, einem RNA-Molekül, übernimmt es die Kontrolle von zentralen Zellsteuerungen und überschreibt im Zellkern das Bauprogramm. Als Nächstes werden Arbeiter auf den Plan gerufen. Wichtige Prozesse stellen auf Virusproduktion um. Die Zelle mutiert zu einer geheimen Virenfabrik. Schnell wird ein neues Virus-Teilchen nach dem anderen ausgespuckt. Schaut sich eines um, sieht es lauter Kopien von sich selbst.
In nur sechs bis acht Stunden wachsen sie zu einem Pulk von rund 1000 Virenneulingen heran. Je mehr sie werden, desto enger wird es in der Zelle, klaustrophobisch schon fast. Es gibt ein Gedrängel. Die Ersten fangen an, nach einem Weg nach draussen zu suchen, und finden ihn da, wo normalerweise der Müll abtransportiert wird. Sie hauen ab. Bloss raus hier.
Es ist eine Frage der Zeit, bis die Tarnung auffliegt. Die Wirtszelle droht langsam zusammenzubrechen. Ihre Systeme sind überlastet und kollabieren. Wenn gar nichts mehr geht, aktiviert sie ein Selbstzerstörungsprogramm. Zum Schutz der anderen begeht die gekidnappte Zelle Selbstmord. Sie zerfällt in all ihre Einzelteile. Für die Viren ist das im ersten Moment eine gute Sache. Endlich sind sie frei, endlich können sie das tun, was sie eben tun: ausschwärmen und sich auf eine der Nachbarzellen stürzen, wo alles von vorne beginnt. Wären da nicht plötzlich all diese Fresszellen, die ihnen den Weg abschneiden, sie umzingeln und attackieren.
Viren gegen Fresszellen
Die entscheidende Phase hat begonnen. Das Virus ist aufgeflogen, vom menschlichen Immunsystem erkannt und lokalisiert. Nun muss es sich gegen die Helfer wappnen, die von überall herbeieilen. Fresszellen sind die Ersten, die sie beseitigen und rausschaffen wollen. Vor ihnen sind auch jene Viren nicht sicher, die bereits in einem Wirt sitzen. Es ist ein Gemetzel. Die Mundhöhle verwandelt sich in ein Schlachtfeld und ebenso der Rachen. Alles wird rutschig und klebrig und schleimig. Die Viren versuchen sich irgendwo festzuhalten, um nicht vom Schleim mitgerissen und in einem Taschentuch entsorgt zu werden. Zwei bis zwanzig Tage, nachdem die erste Zelle infiziert wurde, sind die ersten Symptome spürbar, Schnupfen, Halsschmerzen oder Husten. Aus dem Virus Sars-CoV-2 ist die Atemwegserkrankung Covid-19 entstanden (siehe Box). Jetzt spürt der Mensch nicht mehr das Virus, sondern die Reaktion des Immunsystems darauf. Die Frage: Wie gut funktioniert sie? Wer ist effizienter, die körperliche Abwehr oder das Virus?
In den meisten Fällen ist Sars-CoV-2 nicht erfolgreich. Dann kann es froh sein, wenn es von einem Hustenstoss ausgepustet und an der frischen Luft nochmals neu beginnen kann, auf einem Gartentisch zum Beispiel oder an einer Türfalle.
Jeder fünfte Fall verläuft schwer. Das Virus breitet sich weiter aus. Den Rachen hinab Richtung Lunge. Obwohl das immer schwieriger wird, es sich beeilen muss, denn plötzlich ist es überall so heiss. Die Abwehr lässt die Körpertemperatur weiter steigen, bessere Fresszellen eilen heran, sogenannte Grossfresser, die dem Virus den Garaus machen.
Nach ein paar Tagen muss es vor Killerzellen fliehen, die sich ebenso schnell vermehren wie die Viren in ihren Virenfabriken. Am bedrohlichsten sind die Antikörper, die das System der Viren erkannt haben und es auf deren Zacken abgesehen haben. Sind sie neutralisiert, ist das Virus ausser Gefecht gesetzt. So gefährliche Gegner gibt es noch nicht überall. Ist das Immunsystem geschwächt, hat das Virus ein leichtes Spiel. Ärzte in der Schweiz bekämpfen es dann mit dem antiviralen HIV-Medikament Kaletra, dem Malaria-Mittel Chloroquin oder dem neuartigen antiviralen Medikament Remdesivir. Es ist in der Schweiz knapp, wird in Notfällen eingesetzt, da es noch nicht zugelassen ist. Es soll aber schon bald in klinischen Studien abgegeben werden. Verhindern sollen die Medikamente, dass sich das Virus dorthin frisst, wo es wirklich gefährlich wird: tief in die unteren Lungenzellen. Dort kann es ein regelrechtes Massaker anrichten, Lungenbläschen befallen und das gesamte Gewebe. Es wird gefährlich.
Kampf um die Lunge
Ganz ohne Widerstand kann sich Sars-CoV-2 in den Lungen nicht ausbreiten. Die Grossfresser greifen es an. Es kommen T-Zellen dazu, die sich gegen das Virus stellen, dazu ein ganzer Cocktail von hormonartigen Botenstoffen. Allesamt signalisieren: Alarm in den Lungen. Es gilt jetzt, den Feind zu bekämpfen. Können sie die Lungen nicht schützen, droht der totale Zusammenbruch. Das Immunsystem versucht verzweifelt, mit dem Virus infizierte Zellen zu entfernen. Oft wissen sie gar nicht mehr, wen sie angreifen. In der Lunge kommt es zu einem riesigen Schlamassel, ein grosses Infiltrat von Zellen produziert zwischen dreissig und vierzig verschiedene Enzyme. Diese Botenstoffe senden einen Befehl aus: Passt auf! Wehrt euch! Vermehrt euch! Alles ist zündrot, geschwollen, wund. Druck baut sich auf. Der Schmerz nimmt zu, da nahe liegende Nervenzellen zusammengedrückt werden. Die Körpertemperatur steigt weiter an, da unzählige Zellen kaputtgehen.
Und das führt im Körper zu einem unkontrollierbaren Zustand. Zumal die Lungen nicht mehr fähig sind, richtig Sauerstoff aufzunehmen. Das Immunsystem ist vollkommen überfordert. Es kommt zu Schwellungen, da die Lungenbläschen dick und verstopft sind. Zudem verknappt sich die Zufuhr von Sauerstoff, was die Situation noch schlimmer macht. Schleim, der sich bildet, kann nicht mehr abfliessen. Der Patient ringt nach Luft, atmet immer schneller. Trotzdem stellt sich ein Gefühl grosser Atemnot ein. Es droht ein Tod durch Ersticken. Über eine Sonde müssen Ärzte Sauerstoff zuführen. Sie erhöhen dessen Konzentration von den normalen 20 Prozent auf 50 bis 70 Prozent. Die Tropfen in den Lungen vergrössern sich, aus den Zwischenlungen tritt Flüssigkeit aus. Der Atemtrakt wird schwächer. Die Entzündung dehnt sich von den Lungen auf den ganzen Körper aus.
Möglich sind Herzrhythmusstörungen, ein Aussteigen der Nieren, Blutdruckabfall, ein multiples Organversagen. Alles zusammen führt zu einem Kollaps des Immunsystems. Zuletzt ist manchmal nicht einmal ganz klar, woran jemand stirbt.
Der Patient ist sediert und bekommt kaum mehr etwas mit. Wer überlebt, kann sich meist nicht mehr erinnern, was das Virus mit ihm gemacht hat. Noch ist nicht klar, ob eine genesene Person fortan immun gegen das Virus ist.
Und das Virus, dieser winzige Grobian? Stirbt der Mensch, ist es erledigt. Es sei denn, er hat vor dem Tod gehustet und das Virus nach aussen getragen. Dann sucht es einen neuen Wirt, und alles beginnt von vorn.
Für kurze Zeit erhält das Virus ein Dasein, sonst ist es immer halbtot und nie lebendig.