Von Peter Hossli (Text), Pascal Mora (Foto) und Priska Walliman (Infografik)

Nach nur vierzig Minuten Fahrt erreichte der Delegierte des Bundesrates für humanitäre Hilfe die syrische Hauptstadt Damaskus. «Verblüffend normal ist der Alltag», so Bessler. Jetzt sitzt er wieder in seinem Berner Büro, eben zurück aus Syrien, wo seit fünf Jahren der Bürgerkrieg tobt – mit weit über 400 000 Todesopfern. Genaue Zahlen fehlen.
Aus einem regionalen Konflikt ist ein «Weltmachtkampf» gewor-den, wie «Der Spiegel» schreibt. Wo Russen, Amerikaner, Iraner und Saudis um Einfluss pokern. Und wo deshalb Millionen leiden müssen.
Dennoch sagt Bessler: «In Damaskus sind die verstopften Strassen das Schlimmste.» Seit drei Jahren reist er nach Syrien, sein Auftrag: humanitäre Diplomatie. Oft verhandelt er mit dersyrischen Regierung. Stets geht es um besseren Schutz für die Zivilbevölkerung und besseren Zugang für humanitäre Helfer. Auf seiner jüngsten Reise besprach er zudem das Schicksal der Palästinenser.
Sechs Treffen hatte er bisher mit Ministern des Diktators Bashar al-Assad (51). Bessler: «Die syrische Regierung ist selbstsicherer geworden.»
Schockiert ist die Welt über die Brutalität, mit der die syrische Armee in Aleppo vorgeht. Präsident Assad signalisiert damit: Er sucht die Lösung auf dem Schlachtfeld, nicht am Verhandlungstisch. Was wenig überrascht. Er weiss Russland hinter sich. Und er verzeichnet militärische Erfolge. Die Frontlinien verschieben sich zu seinen Gunsten. Aus Sicht Assads sind die 200000 eingekesselten Bewohner in Aleppo «Terroristen».
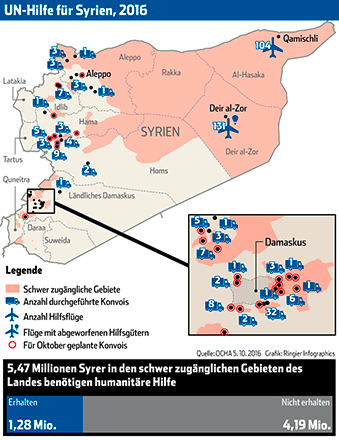
Davon sind über 13,5 Millionen täglich auf humanitäre Hilfe angewiesen. Wobei 5,47 Millionen in Regionen leben, die belagert oder nur schwer und unregelmässig zu erreichen sind.
Rund 6,1 Millionen Syrer ziehen als Binnenflüchtlinge durchs Land. «Die humanitäre Hilfe sichert ihr Überleben», so Bessler, «aber nicht das Leben.» Eine politische Lösung sieht er nicht. «Wir verteilen Pflaster, niemand geht die Ursache an.»
Wie Teppichhandel
Zumal «über humanitäre Hilfe wie Teppiche verhandelt wird», sagt der Diplomat. Hört die Regierung etwa, dass die Opposition fünf Lastwagen durchlasse, lässt sie auch fünf durch, stellt aber neue Bedingungen. Tage dauere es, bis die Hilfe am richtigen Ort ankommt. «Alles geschieht auf dem Rücken der Zivilisten.»
Die Kriegswirtschaft boomt. Verfünffacht haben sich Preise für Lebensmittel. «Gewisse Leute haben ein Interesse, dass der Krieg weitergeht.» Gross ist das Leid. Eine Million Häuser sind kaputt, dazu 70000 Fabriken. 4,6 Millionen haben das Land als Flüchtlinge verlassen.

Er blickt auf die Landkarte vor ihm. Die Türkei wolle keine solchen Städte. «Im Libanon leben bereits heute schon mehr als eine Million syrische Flüchtlinge, jeder vierte Flüchtling ist ein Syrer.» Der Irak drohe immer tiefer im Chaos zu versinken. Der Tenor in Jordanien: Das Boot ist voll.
Abgesehen von politischen Hindernissen sieht Bessler praktische Probleme. «Eine solche Stadt wäre ein Anziehungspunkt – auch für Extremisten.» Kämpfer könnten dort versuchen, junge Leute zu rekrutieren oder sich eine Zeit lang zu erholen, bevor sie wieder zurück an die Front zögen. Trotzdem seien die Menschen nicht vor Anschlägen gefeit, denn es sei schwierig, solche Städte zu sichern. Nötig wäre eine internationale Polizei. «Kein Land der Region würde dies zulassen, schon gar nicht Syrien, der Libanon oder die Türkei, die am meisten syrische Flüchtlinge beherbergen.»
Bessler fürchtet: «Dieser Konflikt wird uns Jahre beschäftigen.» Enden werde er erst, wenn der Leidensdruck nicht mehr auszuhalten sei.