Text: Peter Hossli Fotos: ZVG Philip Hebel und Daniel Rihs (Bild Hebel in Bern)

Die Frau, die Philip Hebel behandelt, erleidet sicher höllische Schmerzen. Sie schreit aber nicht, röchelt nicht einmal. Sie ist lethargisch und still. Abgestumpft wie Hunderttausende anderer Opfer des Erdbebens, das die Karibikinsel Mitte Januar erschüttert hat. Die Lethargie blockiert ihr Schmerzempfinden.
Drei Tage lag sie mit offenem Fuss unter den Trümmern. Die Person, die sie rausgezogen hatte, legte behelfsmässig einen Gips über den verstümmelten Fuss. Die Wunde wucherte weiter. Als sie zu Hebel kommt, ist ihr Bein bereits bis unters Knie infiziert. Antibiotika nützen da nichts mehr. Sofort muss der Unterschenkel weg. Sonst überlebt die Frau nicht.
Sie ist 25, weiss Hebel. Wie sie heisst, will er nicht wissen. Ganz bewusst lässt er das Leid nicht zu nahe an sich heran. «Um zu überleben, muss ich verdrängen», sagt er. Hebel, 36, sitzt im City Notfall in Bern, einer ambulanten Klinik unweit des Bahnhofs. Der Hannoveraner ist hier Internist. Seit acht Jahren lebt und arbeitet er in Bern. Jetzt erzählt er, wie er nach Haiti kam und was er erlebte.
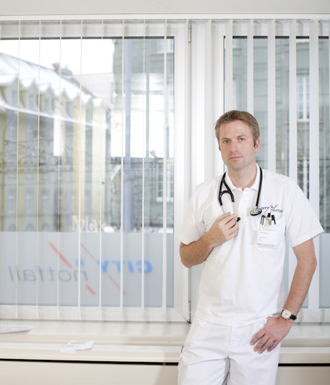
Hebel hilft, ein Spital für Blinde in eine chirurgische Station umzugestalten. «Blinde können warten, es geht um Leben und Tod», sagt er. In Léongâne im Nordwesten der «fast gänzlich zerstörten Stadt» richtet er ein Feldlazarett ein. Es besteht aus einem Zelt, zwei Feldbetten und zwei schweren Kisten. Darin lagern Pillen und Pulver, Verbände und Pflaster.
Der Arzt hat ein Skalpell, eine Pinzette und eine Lösung zum Spülen. Damit betreibt er zehn Tage lang «Medizin im Stehen», Akkordarbeit unter brütender Sonne. Am ersten Tag herrscht Chaos. Überall, wo es etwas zu essen gibt, wo ein Arzt steht, stauen sich Menschen. Keiner stellt sich in die Schlange. Jeder drängt. Hebel greift sich die lautesten und heuert sie an, «um den starken Max zu machen», sagt er. Sie ordnen das Chaos, stellen und setzen Patienten in eine Reihe. Er entlöhnt sie mit Weissbrot und Erdnussbutter, das einzige Essbare, das Hebel vorerst hat.
Am ersten Tag empfängt er 50 Patienten, am zweiten 150, am dritten 160. Sie kommen mit tiefen Fleischwunden, verstümmelten Gliedern, mit zertrümmerten Schädeln. Der Arzt aus Bern schneidet infiziertes Gewebe weg, säubert, verbindet. Sagt einer Patientin, sie soll morgen wieder kommen, zur Nachkontrolle. Jene, die keiner abholt, die nicht mehr gehen können, legen sich vors Zelt.

Hebel trägt Gummihandschuhe, die er aus Bern mitgenommen hat. Er weiss: Haiti hat eine hohe HIV-Rate. Die Pinzette übergiesst er mit Alkohol. Regelmässig wäscht er sich die Hände. Er macht sich aber nichts vor: «Wir mussten in Haiti so unsteril arbeiten, in der Schweiz würde ich dafür verklagt werden.»
Zwar spreche er ordentlich Französisch, Haitis Landessprache. Die meisten seiner Patienten verstehen aber nur Kreolisch. Mit weissem Brot und klebriger Nussbutter bezahlt er auch zwei Übersetzer. Das bringt ihn näher zu den Patienten als die kubanischen Ärzte. «Die sind zwar gut ausgebildet, aber sie können mit niemandem reden.»
Scham zeigen seine Übersetzer selten. Sie äugen, wenn eine Patientin da liegt. Hebel ist überrascht, wie öffentlich er praktizieren muss. Auch Schwerverletzte, die demnächst unters Messer kommen, sind zuerst einmal nur Schaulustige. «Ich verstehe bis heute nicht, warum einer bei einer Amputation zuschauen will, der kurz danach ebenfalls sein Bein verlieren wird.»
Er sieht Wunden, in denen sich Eintagsfliegen einnisten. Maden beschleichen verwestes Fleisch. «Das ist an sich etwas Gutes», erklärt der Arzt aus der Ersten Welt. Maden sind Wundheiler, ähnlich wie er es ist. Sie fressen kranke Haut, rühren aber gesundes Gewebe nicht an. Er tut dasselbe mit dem Skalpell.

Anfangs führt der Arzt aus Bern noch Buch über die Gebrechen, die er behandelt. Am zweiten Tag hört er damit auf, wie andere auch. Täglich kann er zwanzig Kranke mehr sehen, hat er berechnet. «Wir haben in Haiti Kriegsmedizin betrieben.» Alles muss schnell gehen. «Der Patient kommt zu mir, ich schaue seinen Fuss an und entscheide dann, ob wir ihn abschneiden oder dranlassen.»
Wegen der vielen Verletzten muss Hebel Patienten ins Zelt nebenan schicken, deren Glieder noch zu retten sind. «Zwei Wochen früher hätten wir viele Amputationen verhindern können.» Etwa mit Wundsaugeschwämmen. Damit säubern Ärzte Blessuren und lindern Infektionen. Bei rund 300 000 Verwundeten war das schlicht nicht möglich. «Selbst in der Schweiz wäre es unter solchen Umständen zu Massenamputationen gekommen.»
Hebel schläft zwei Autostunden von der Krankenstation entfernt. Mit hundert anderen teilt er eine Dusche. Zwei Minuten steht er täglich unter fliessendem Wasser. Manchmal isst er zum Weissbrot mit Erdnussbutter noch eine Mango. Um sieben Uhr früh steigt er auf die harte Ladefläche eines offenen Pickup-Trucks und lässt sich zu seinem Lazarett fahren.

Bewusst habe das amerikanische Militär kampferprobte Eliteeinheiten ins Erdbebengebiet entsandt. «Nicht um das Land zu besetzen, sondern um mit den Gefahren und dem extremen Leid fertigzuwerden», sagt Hebel.
Einem drei Monate alten Baby ist ein Betonklotz auf den Kopf gefallen. Diagnose: Schädelbruch und ein «geschlossenes Loch» mit einem Durchmesser von fünf Zentimetern. Eine riesige Beule drückt das Hirn ein. Das Kind wirkt träge und trinkt kaum noch. Viel zu spät bringt es die Mutter zum Arzt. Es ist fast ausgetrocknet, hat höchstens noch zwei Tage zu leben. Keiner der Chirurgen wagt den schwierigen Eingriff, auch Hebel nicht.
Am selben Tag trifft er Cody, ein taffer US-Marinesoldat auf Patrouille, «der direkte Fragen stellt und kurze Antworten mag», sagt der Arzt. Er brauche etwas zu essen für sein Team und ein paar Sägen, bittet der Deutsche den Amerikaner. Dann führt er Cody zum Baby mit der Beule am Kopf. «Für dieses Kind brauche ich dringend einen Hubschrauber.»

Wie es heisst, das weiss er nicht. Er ist nicht mal ganz sicher, ob es ein Bub oder ein Mädchen war. Hat das Kind überlebt? «Davon gehe ich aus», sagt Hebel. «Aber ich will es gar nicht genau wissen. Wenn das Kind jetzt tot sein sollte, würde mich das schon sehr belasten.»
Verdrängung ist bei Philip Hebel ein Prinzip: «In Haiti gibt es unzählige grauenhafte Einzelschicksale. Hätte ich jedem zugehört, wäre ich daran zugrunde gegangen.»
Operierende Reporter
Wie US-Fernsehsender das Leid dramatisierten
Sanjay Gupta, 40, ist beim US-Nachrichtensender CNN ein Star im Reporterteam. Nebenbei arbeitet er als Neurochirurg. Das macht ihn zum wertvollen Angestellten. Als einer der ersten US-Journalisten kam er im Erdbebengebiet Haitis an. Kaum war er gelandet, streifte er Gummihandschuhe über und legte eine Operationsmaske an. Vor laufender Kamera untersuchte er ein 15 Monate altes verletztes Mädchen. «Sie bewegt beide Arme, das ist ein gutes Zeichen», sagte er und zeigte auf eine Fleischwunde am Kopf. «Ich hoffe, ihr Schädel ist nicht gebrochen.» Perfektes TV-Drama. Bereits im Irak-Krieg operierte Gupta vor laufender Kamera und erzielte damit hohe Einschaltquoten. Andere US-Sender folgten und stellten Ärzte als Reporter an. Eine CBS-Ärztin half in Haiti bei einer Amputation. Ein Arzt im Sold von NBC wickelte eine Geburt ab. Dass US-Reporter auch Heiler sind, entfachte in Amerika eine Debatte über medizinische wie journalistische Ethik. Journalisten dürften nie Thema ihrer Geschichten sein, sagte Gary Schwitzer, Professor für Journalismus an der Univesity of Minnesota. «Entweder du bist Arzt, oder du bist Reporter.» Berichte ein Journalist darüber, wie er operiert, gehe jede Objektivität verloren.
Schade, dass Journalisten auf solche reisserischen Erzählungen hereinfallen und nicht weiter recherchieren, was davon der Wirklichkeit entspricht.Aerzte ohne chirurgische Ausbildung, ohne Erfahrung in Kriegschirurgie und ohne Ausrüstung so auf die Verletzten in Haiti loszulassen ist unethisches Handeln.