Von Peter Hossli

Selbst ausgestattet mit amerikanischen Dollar und Schweizer Kreditkarte ist es im Dezember 1993 schwierig, in der kubanischen Hauptstadt etwas zu essen. Die Zuckerinsel, einst der Juwel der Karibik, darbt.
Es sei denn, man heisst Fidel Castro.
Fest im Palacio de la Revolución
Havanna feiert das 15. Festival des lateinamerikanischen Films. Für den «Tages-Anzeiger» berichte ich darüber. Der Comandante en Jefe – wie Castro alle nennen, der Oberbefehlshaber der Armee – lädt Journalisten, Schauspieler und Regisseure gegen Ende des Festivals in den Palacio de la Revolución.
Vor dem Prunkgebäude mit den dicken Säulen flattert eine riesige kubanische Flagge. Drinnen hängen Kronleuchter an der Decke, gut genährte Soldaten bewachen die Säle.
Auf dem Buffet liegen Berge von Lebensmitteln: frische Früchte, Fleisch, Fisch, Reis, Brot und Käse, «aus kubanischer Milch», sagt ein Koch und grinst. Endlich werde ich satt.
Kaum ist eine Schale leer, füllt er sie nach. Rum fliesst, dicke Zigarren machen die Runde. Es gibt Mojitos, «todo se puede beber», so viele wie man trinken mag.
Grüne Uniform, brauner Bart
Ein Gedanke nagt: das Volk hungert, während der Diktator hinter hohen und dicken Mauern schlemmt.
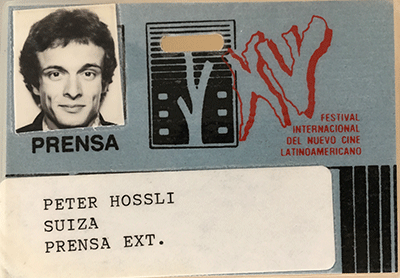
Rasch bildet sich eine Menschentraube um den damals 67-jährigen Fidel, die Bodyguards lassen vieles zu. Smartphones gibt es noch keine. Statt für Selfies zu posieren, drückt der Comandante Hände, küsst Frauen auf Wangen, winkt.
Schlabbrig und gleichgültig
Natürlich gehe ich auf ihn zu. Plötzlich steht er vor mir – wow, eine historische Figur. «Soy un periodista suizo», sage ich, damals 24 Jahre alt. Irgendwie tief beeindruckt, fällt mir nicht mehr ein, blicke Castro aber direkt Gesicht.
Er streckt mir die Hand hin, ich greife zu, von ihm kommt: nichts. Schlabbrig-gleichgültig hält er die Hand hin. Sie ist feucht und warm. «Bienvenido a Cuba», sagt Fidel und geht weiter.
Wische mir die Hand an der Hose ab. Nach einer halben Stunde zieht sich Castro zurück. Und hinterlässt ein mulmiges Gefühl. Der Händedruck des Máximo Líder ist feucht, weich und alles andere als zupackend. Während er wie im Schlaraffenland lebt, hungert sein Volk.
Erst später realisierte ich, wie viel sagend die Begegnung in Havanna war. Die Revolution, die Castro 1956 mit Che Guevara, Camilo Cienfuegos und Bruder Raúl Castro lostrat, war längst gescheitert. Vor mir stand ein gescheiterter Mann.
Das Volk hat ihn durchschaut
Sicher, er hatte das Land von einem geldgierigen Diktator Fulgencio Batista befreit.
Doch längst war Castro selbst ein Diktator geworden. Misswirtschaft und Kommunismus hatten zu einer prekären Versorgungslage geführt. Castro gab der Blockade der USA die Schuld für die missliche Lage – und lebte gleichzeitig in Saus und Braus.
Das Volk hatte ihn durchschaut. Jeden Tag würde er in einem anderen Haus übernachten, im Bett einer anderen Frau, erzählten mir im Dezember 1993 viele Kubaner. Es war Abscheu nicht Bewunderung. Die Menschen? Gezeichnet vom Stress des Alltags.
Er wolle ihm die Kehle durchschneiden, sagte mir ein Kubaner. «Aber sag das niemanden, an jeder Ecke lauert der Geheimdienst.» Er hatte nur ein Ziel: «Kuba so schnell wie möglich zu verlassen.»
Angst prägte Kuba, nicht die Freude, über die Revolutionsromantiker so gerne berichteten. Von all dem wollte Fidel Castro nichts wissen.