Von Peter Hossli (Text), Pascal Mora (Fotos) und Priska Wallimann (Infografik)

Gebannt hören die Frauen zu, wie Pillen und Spiralen auf ihre Körper wirken, wie Kondome und Femidome zu handhaben sind. Der Krieg im Nachbarland Syrien hat sie hierhergetrieben, in den Libanon. Manch eine ist seit fünf Jahren da – so lange schon sprechen die Waffen. Die wenigsten wissen noch, warum einst der erste Schuss fiel. Zurück aber wollen alle. «Um aufzubauen, was noch da ist», sagt die islamische Frau, die den Verhütungskurs in der Klinik in der Bekaa-Ebene besucht. «Eine zu grosse Familie wäre da hinderlich.»
«Es ist ein Wunder»
Mit ihr harren über eine Million registrierte syrische Flüchtlinge im Libanon. Schätzungen gehen sogar von 1,5 Millionen aus – das wären rund 30 Prozent aller Einwohner. Kein anderes Land ist so sehr von der Syrien-Krise betroffen wie «die Schweiz im Nahen Osten». Es gibt Regionen im Libanon, wo mehr Syrer als Libanesen leben. Arbeiten dürften die Flüchtlinge zwar nicht. Viele tun es illegal. Das drückt die Löhne. Mieten klettern. Der Wasserverbrauch im trockenen Land stieg seit 2011 um
28 Prozent. Überlastet sind Schulen und Spitäler. Meterhoch türmt sich vielerorts stinkender Müll.

Die Krankenpflegerin Ehkram Marda bietet syrischen Flüchtlingen in einer Klinik in der Bekaa-Ebene Verhütungs-Kurse an.
Die Krankenpflegerin Ehkram Marda bietet syrischen Flüchtlingen in einer Klinik in der Bekaa-Ebene Verhütungs-Kurse an.

Erst vor einem Monat kam die 17-jährige Syrerin Israa im Libanon an. Auf ihrem Arm schläft der einjährige Quasay. Sie hat einen Verhütungs-Kurs besucht – und nimmt jetzt die Pille.
Erst vor einem Monat kam die 17-jährige Syrerin Israa im Libanon an. Auf ihrem Arm schläft der einjährige Quasay. Sie hat einen Verhütungs-Kurs besucht – und nimmt jetzt die Pille.

Das Zeltlager 003 auf der Bekaa-Ebene beherbergt rund 2000 syrische Flüchtlinge. Insgesamt leben 1,07 Millionen registrierte Flüchtlinge aus Syrien im Libanon. Schätzungen gehen von 1,5 Millionen aus.
Das Zeltlager 003 auf der Bekaa-Ebene beherbergt rund 2000 syrische Flüchtlinge. Insgesamt leben 1,07 Millionen registrierte Flüchtlinge aus Syrien im Libanon. Schätzungen gehen von 1,5 Millionen aus.

Die palästinensische Sozialarbeiterin Nisreen Ashour spielt im Südlibanon mit syrischen Flüchtlingskindern – um sie zu stärken. «Diese Kinder haben in ihrer Heimat Schreckliches erlebt, jetzt geht es darum, dass sie ihre Kindheit nicht ganz verlieren.»
Die palästinensische Sozialarbeiterin Nisreen Ashour spielt im Südlibanon mit syrischen Flüchtlingskindern – um sie zu stärken. «Diese Kinder haben in ihrer Heimat Schreckliches erlebt, jetzt geht es darum, dass sie ihre Kindheit nicht ganz verlieren.»

Die zehnjährige Jawaher floh mit ihrer Familie aus Homs in den Libanon. Jetzt lernt sie, sich zu wehren.Sie möchte Ärztin in Syrien werden.
Die zehnjährige Jawaher floh mit ihrer Familie aus Homs in den Libanon. Jetzt lernt sie, sich zu wehren.Sie möchte Ärztin in Syrien werden.

Jawaher lebte in Syrien in einem grossen Haus. Nun bewohnt die Familie ein enges dunkles Zelt, das neben einem Tanklager im Südlibanon steht. Ein kleiner Bach trägt Abfälle und Abwasser ins Meer.
Jawaher lebte in Syrien in einem grossen Haus. Nun bewohnt die Familie ein enges dunkles Zelt, das neben einem Tanklager im Südlibanon steht. Ein kleiner Bach trägt Abfälle und Abwasser ins Meer.

In diesem unfertigen Haus im Südlibanon wohnen rund 1200 syrische Flüchtlinge. Die Fenster sind mit Plastik bedenkt, es hat keine Toiletten und keine Küchen in den Wohnungen.
In diesem unfertigen Haus im Südlibanon wohnen rund 1200 syrische Flüchtlinge. Die Fenster sind mit Plastik bedenkt, es hat keine Toiletten und keine Küchen in den Wohnungen.

Mutter, Grossmutter und Tochter sind aus Syrien geflohen. Sie leben in einem unfertigen Gebäude im Südlibanon.
Mutter, Grossmutter und Tochter sind aus Syrien geflohen. Sie leben in einem unfertigen Gebäude im Südlibanon.

Der 32-jährige Syrer Hassan treibt im gelben Bachsteinhaus im Südlibanon die Miete ein. Er beklagt sich, dass es nicht einmal Land für Begräbnisse gebe. «Meine Mutter ist schwer krank, stirbt sie, werfe ich sie in die Bananenstuden.»
Der 32-jährige Syrer Hassan treibt im gelben Bachsteinhaus im Südlibanon die Miete ein. Er beklagt sich, dass es nicht einmal Land für Begräbnisse gebe. «Meine Mutter ist schwer krank, stirbt sie, werfe ich sie in die Bananenstuden.»
Bedroht ist das heikle libanesische Gleichgewicht aus Schiiten, Sunniten, Maroniten, Drusen und Christen. Zumal die meisten syrischen Zuwanderer Sunniten sind. Weiter an den Rand gedrängt sehen sich die rund 330000 Palästinenser. Sie haben seit 1948 den Flüchtlingsstatus im Libanon. Warum bricht der Kleinstaat ob dieser Last nicht auseinander? «Es ist ein Wunder», sagt Suheir El Ghali vom Sozialministerium. Libanesen fühlten sich verpflichtet. «Syrer öffneten 2006 ihre Arme als wir Krieg führten und flohen», sagt sie. «Jetzt helfen wir.»
Wie in Zahlé in der Bekaa-Ebene, dem fruchtbaren Hochtal im Osten des Landes. In der Klinik macht Pflegerin Marda, was für die Zukunft Syriens so zentral ist: Sie stärkt Frauen.
Müttern zeigt sie, wie sie Kinder mit Durchfall pflegen, dass Brustmilch gesünder als Flaschenmilch ist. «Dass sie zwischen jedem Kind zwei Jahre warten sollten – das ist gut für euch und die Kinder.» Die Frauen würden die Kondome benutzen. «Die Männer aber zögern.» Was tut sie dagegen? «Ich bestelle die Männer zu mir, hier gehorchen alle!»
Schweizer Hilfe
Das Schweizer Hilfswerk Medair unterstützt das Spital finanziell mit Spenden der Glückskette. Dank des Geldes könnten neu täglich 50 statt zehn Patienten behandelt werden. Zwei Dollar kostet eine Arztvisite, etwa so viel wie eine Schachtel Zigaretten. Es sei wichtig, dass die Patienten etwas zahlten, so Marda. «Es stärkt ihr Selbstbewusstsein.»
Mit Verbrennungen kämen die meisten ins Spital. Die Flüchtlinge wohnen in Zelten aus Plastik, die rasch Feuer fangen. Sie kochen mit Holzöfen, an denen sich kleinere Kindern verbrennen. Israa ist hier, weil sie vorerst kein zweites Kind will. Sie ist 17, friedlich schläft der einjährige Quasay auf ihrem Arm. Erst vor einem Monat kam sie im Libanon an, nach einer vier Jahre langen Odyssee durch Syrien. «Wir flohen vor Bomben, zuletzt hatten wir nichts mehr zu essen und schlichen über die geschlossene Grenze.»
Israa ist kein Kind mehr, aber noch nicht ganz erwachsen. An ihren Fingernägeln blättert rote Farbe ab, ihre Augenbrauen hat sie gestutzt, das Haar liegt unter einem dunklen Kopftuch, traurig wirken ihre schönen Augen. «Seit ich 13 bin, lebe ich in Angst.»
Weil sie sich fürchtete, habe sie mitten im Krieg ihren vier Jahre älteren Jugendfreund geheiratet. Mit ihm fühle sie sich sicherer. «Aber es reicht nicht, um Syrien sicher zu machen.» Israa will zurück. «Es liegt jetzt an uns, an uns jungen Frauen, das Land aufzubauen.» Mit mehreren Kindern schaffe sie das nicht. Ist ihr Mann einverstanden, dass sie im Libanon begann, die Pille zu nehmen? «Das habe ich so entschieden.»
Der syrischen Mittelklasse gehörte Israa an, lebte in Homs in einem dreistöckigen Haus. Jetzt bewohnt sie mit Mann, Sohn und den Eltern einen kleinen Raum. Er kostet monatlich 67 Dollar Miete. Ihr Mann füllt Pepsi-Dosen ab. Und verdient die Hälfte von dem, was seine Familie braucht.
Wie fast alle Syrer im Libanon muss sich die Familie von Israa verschulden. Bei fast 900 Dollar liegt die durchschnittliche Schuldenlast. An Arbeit für Männer mangelt es im Libanon. Frauen und Kinder finden schlecht bezahlte Jobs in Zitronenhainen, auf Bananen- und Tabakplantagen.
Schulen führen doppelte Schichten. Trotzdem kann nur die Hälfte aller Flüchtlingskinder lernen. Erschwerend ist: Libanesische Lehrerinnen halten den Unterricht in Englisch und Französisch ab, den Sprachen der Kolonialmächte. Syrische Kinder aber sprechen oft nur Arabisch.
Rasant angestiegen ist im letzten Jahr die Anzahl syrischer Mädchen, die mit zwölf oder 13 an Libanesen verheiratet werden. Die Eltern hoffen, so zu einer Arbeitsbewilligung zu kommen.
Mädchen stärken
Zehn Jahre alt ist Jawaher. Keck leuchten ihre grossen dunklen Augen. Sie steht in einem Zelt im Süden Libanons – und spricht vor zwölf Mädchen selbstbewusst, was sie eben gelernt hat. «Wir tragen immer Kleider, niemand darf uns berühren, wenn wir es nicht wollen, und niemand darf uns schlagen, auch nicht der Vater oder die Mutter.»
Aus Homs floh ihre Familie in den Libanon. Wann? Sie weiss es nicht mehr. An ihr Zimmer könne sie sich vage erinnern – «es hatte viele Puppen» – und an ihr Haus. «Alle hatten eigene Zimmer, nur meine Mutter und mein Vater teilten es.»
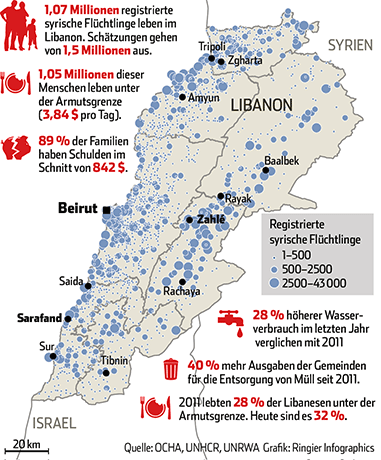
Auf dem Weg dorthin begleitet sie Nisreen Ashour (32), eine palästinensische Sozialarbeiterin im Dienste des Schweizer Hilfswerks Terre des hommes. Ashour kniet auf dem Boden, zeichnet mit Kindern, spielt mit ihnen, erzählt Geschichten, singt. «Diese Kinder haben in ihrer Heimat Schreckliches erlebt, jetzt geht es darum, dass sie ihre Kindheit nicht ganz verlieren.»
Es geht darum, sie zu stärken – und zu schützen. Zumal die Kinderarbeit im Libanon stark zunehme, sagt die Neuenburgerin Aurélie Péter-Contesse (32). Sie leitet das Terre-des-hommes-Büro. «Libanon ist teurer, die meisten Flüchtlinge haben ihre Ersparnisse längst aufgebraucht, es ist ihnen nicht erlaubt zu arbeiten. Deshalb schicken sie ihre Kinder auf die Strasse und auf Felder.»
Die Kleinen betteln zwischen Karossen auf den breiten Boulevards der Hauptstadt Beirut, verkaufen Kaugummi, pflücken im Süden Orangen, ernten auf der Bekaa-Ebene Gurken, Salate und Tomaten.
Keinen Platz für Tote
Das Geld, das sie verdienen, geben ihre Eltern grösstenteils für die Miete aus. Die ärmsten syrischen Flüchtlinge hausen in unfertigen Häusern. Einen kargen, gelben Bachsteinbau bewohnen 1200 Menschen im Südlibanon. Fast alle flohen aus den kriegsversehrten Städten Homs und Aleppo. Im Schnitt sieben Personen teilen sich einen Raum. Nicht Glas, sondern schmutzige Plastikfetzen bedecken die Fenster. Küchen und Toiletten fehlen. «Wir leben wie Tiere», sagt Hassan. Er zeigt auf das Rinnsal, das neben dem Gebäude menschliche Ausscheidungen wegspült. Hassan ist 32, sein weisser Bart lässt ihn älter wirken. Er treibt die Mieten ein – nach Grösse des Raums zwischen 83 und 133 Dollar. «Fast alle sind im Verzug», sagt Hassan.
Kinder rennen durch dunkle Flure. Frauen hängen Wäsche an Leinen. Es ist dreckig, riecht nach Fäkalien. Vor dem Haus liegt eine Bananenplantage. In der Weite ist das kräftige Blau des Mittelmeers zu sehen. Die Sonne scheint und Syrer Hassan wettert. Gegen die Uno, gegen die Hilfswerke, gegen Journalisten. «Alle kommen hierher, fotografieren Elend und gehen wieder, das bringt uns nichts.»
Nicht einmal die Toten dürften sie begraben. Dafür fehle es an Land. «Meine Mutter ist schwer krank, stirbt sie, werfe ich sie in die Bananenstauden», sagt Hassan.
Zeit, zu gehen. Ein Fahrer holt die Reporter ab. «Habt ihr Durst?», fragt er und streckt zwei Flaschen eiskaltes Wasser hin. Für die Flüchtlinge hat er nichts mitgebracht.

Seit 2011 tobt in Syrien der Krieg. Die Schweizer Glückskette sammelt seit August 2012 Geld. Bisher kamen 51,5 Millionen Franken zusammen. Eine beachtliche Summe, sagt Glückskette Direktor Tony Burgener (Bild, 58). «Es ist schwieriger, für Kriegsgebiete als für Naturkatastrophe zu sammeln.» Knapp 14 Millionen Franken hat die Glückskette seit 2011 im Libanon ausgegeben. Derzeit unterstützt sie fünf Organisationen: Solidar Suisse, Medair, Terre des hommes, Das Schweizerische Rote Kreuz, Heks. Spenden: Postkonto 10-15000-6, Stichwort «Flüchtlinge».
