Von Peter Hossli
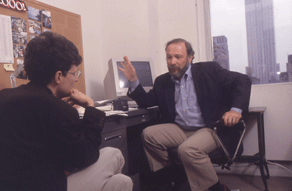
Mister Joe Klein, wer sind Sie eigentlich?
Joe Klein: Was soll die banale Frage? Ich bin Reporter beim “New Yorker”.
Die meisten Leute kennen Sie als einst anonymen, dann enttarnten Autor des Clinton-Schlüsselromans “Primary Colors”.
Klein: Wir alle haben verschiedene Identitäten. Bei mir sind es zwei Karrieren: eine als Journalist, eine als Schriftsteller.
Wer Fiktion und Fakten mischt, schwimmt oft in gefährlichen Wassern.
Klein: Ich geniesse beide Seiten. Gelegentlich fehlt mir aber die Anonymität.
Sie geniessen es, ein Star zu sein?
Klein: Mein Leben hat sich seit “Primary Colors” kaum verändert. Noch immer beantworte ich meine Anrufe, recherchiere selber und schreibe eigene Artikel.
Sie sind ein reicher Mann. Das Buch und die dazugehörigen Filmrechte trugen Ihnen sechs Millionen Dollar ein.
Klein: Eine Erleichterung. Jetzt kann ich die Kinder an Top-Universitäten schicken.
Freunde haben Sie kaum noch. Als Sie nach fünfmonatigem Rätselraten enttarnt wurden, schrieben Kollegen, der Journalismus habe wegen Joe Klein massiv an Glaubwürdigkeit eingebüsst.
Klein: Lächerlich. Der Journalismus verliert an Glaubwürdigkeit wegen Jagden, wie sie gegen mich veranstaltet wurden.
Warum haben Sie gelogen?
Klein: Da ist doch nichts Verwerfliches dran. Die anonyme literarische Form gibt es seit der Bibel. Schriftsteller wie Henry Adams veröffentlichten anonym. Mark Twain ist ein Pseudonym. Als Journalist wurde ich nicht ein einziges Mal wegen falschen Fakten angeklagt.
Im Februar 1996 schrieb das Stadtmagazin “New York”, Joe Klein habe “Primary Colors” geschrieben. Warum bestritten Sie das damals noch?
Klein: Das war ein schwieriger Moment. Der Erfolg des Buches hatte mich komplett überrascht und zeitweilig überfordert. Ich wurde ein bisschen wahnsinnig.
Sie verloren die Kontrolle?
Klein: Überrascht Sie das? Alle waren hinter mir her. Die “Washington Post” stellte acht Reporter frei, um “Anonymous” zu finden. Ein wahre Hetzjagd.
Der Journalist Klein spürte, was die Presse einem anhaben kann?
Klein: In der Woche nach meiner Entdeckung fühlte ich mich wie ein gejagter Politiker. Seither frage ich mich, wie es etwa Clinton schafft, täglich aufzustehen.
“Primary Colors” ist ein hervorragendes Buch. Warum schrieb es “Anonymous” und nicht Joe Klein?
Klein: Einerseits aus Feigheit.
Sie hatten Angst zu scheitern?
Klein: Und wie. Ich war fast fünfzig und hatte noch nie einen Roman geschrieben. Es hätte sehr wohl schief gehen können.
Dann sind Sie ein Snob, der sich keine Fehler eingesteht?
Klein: Ein Snob mit Schalk. Ich wollte an der Sache Spass haben. Das 19. Jahrhundert ist meine bevorzugte literarische Periode. Alle erlaubten sich damals mit Pseudonymen kleinen Scherzchen.
Sie aber schrieben anonym.
Klein: Mein Verleger, der nicht wusste, wer ich war, lehnte ein Pseudonym ab.
Hinter “Anonymous” hätte sich ein Journalist verbergen können, der nicht literarisch schreiben kann.
Klein: Ich wollte “Primary Colors” unter Bedingungen veröffentlichen, wie sie jeder Erstlingsautor hat. Die Kritiker durften nicht wissen, dass ich jemand aus ihrer Branche war. Journalisten schreiben nie nett über Journalisten, die Romane vorlegen. Der Hauptgrund für die Anonymität war aber persönlich. Meine Frau und ich lebten ein normales Leben ohne grosses Aufsehen. Wir hatten Angst, das mit diesem Buch zu verlieren.
Jetzt leben Sie ein normales Leben mit sechs Millionen Dollar auf der Bank. Möglichst lange anonym zu bleiben steigerte doch die Verkaufszahlen. Konnten Sie nicht genug Geld kriegen?
Klein: Das ist Unsinn. Alle Verträge waren unterschrieben, als erste Vermutungen auf mich fielen. Die Filmrechte waren verkauft, ebenso die Übersetzungen und das Taschenbuch. Vermutlich hätte das Buch noch besser verkauft, wenn ich eher rausgekommen wäre.
Dann sind die Journalisten, die Ihnen Geldgier vorwerfen, neidisch?
Klein: Es ist komplexer. Ein Psychiater der American Psychiatric Association hat die Reaktion der Presse auf “Primary Colors” eben erst als Musterbeispiel für Projektionen verwendet. Jeder Journalist kennt Momente, in denen er lügt, um Informationen oder Interviews zu erhalten.
Sie hielten den vermeintlich integren Kollegen den Spiegel vor?
Klein: Das hat sie irritiert. Denn die Welt brauchte nicht zu wissen, wer “Anonymous” war. Niemand nahm Schaden.
Ihr Verhalten zeugt von Naivität. Es gibt doch kein Geheimnis, dass in Washington ein Geheimnis bleibt.
Klein: Ich dachte, ich würde schon nach einer Woche entdeckt werden. Der Schock kam, als es nicht passierte. Plötzlich befand ich mich in einem Territorium, in dem kein einziger anonymer Autor der Literaturgeschichte je war: inmitten newshungriger Massenmedien.
Für ihren damaligen Arbeitgeber “Newsweek” arbeiten Sie heute nicht mehr. Es hiess, sie seien gefeuert worden.
Klein: Eine reine Medienfantasie. Ich arbeite für den “New Yorker”, weil mir hier ein Job angeboten wurde. “The New Yorker” ist das beste englischsprachige Magazin. Hier zu arbeiten, ist eine Ehre.
Diese Woche eröffnet die Kinoversion von “Primary Colors” das Filmfestival von Cannes. Sind sie rehabilitiert?
Klein: Ich benötige keine Rehabilitation. Die Journalisten, die mich diskreditierten, hatten kein Recht, über mich zu urteilen. Das darf nur die Öffentlichkeit.
Und die hat Ihnen vergeben?
Klein: Ein paar Wochen nach dem Outing schrieb ich eine Kolumne über eine katholische Schule in einem armen Quartier in Chicago. Mehr als 1000 Leser von “Newsweek” schickten der Schule Geld. Mehr möchte ich zu meiner journalistischen Glaubwürdigkeit nicht sagen.
Ist denn die US-Presse nach den jüngsten Skandalen noch glaubwürdig?
Klein: Was in den letzten Monaten hier passierte, ist absolut peinlich. Lange vor “Primary Colors” habe ich gesagt, Hetzjagden wie diejenige auf Clinton fügen der Gesellschaft weit mehr Schaden zu als die schuldigen Einzelpersonen. Wer will da noch Politiker werden? Wir Journalisten vertreiben gute Leute aus der Politik.
Habt Ihr nichts Besseres zu tun?
Klein: Hier liegt das Problem. Der Clinton-Skandal konnte nur passieren, weil nichts passiert. Wir erleben eine Phase, die es im 20. Jahrhundert noch nie gegeben hat: Grosse weltpolitische Herausforderungen fehlen, die Wirtschaft boomt bei tiefer Inflation. Sogar das soziale Gefälle hat sich in den USA verringert. Über was sollen wir da noch schreiben? Einfallslose greifen zur Affäre.
Jetzt heucheln Sie. In “Primary Colors” attackierten Sie Clinton ebenfalls mit Affären.
Klein: Attacken? Es gibt Leute, die sagen, das Buch sei pro Clinton. Es ist weder noch, sondern eine Beschreibung der unerträglich gewordenen Atmosphäre, von der alle genug haben. Das amerikanische Volk hat bei Meinungsumfragen deutlich gezeigt: Es ist fähig, Präsidenten auf Grund ihre Arbeit zu beurteilen und nicht auf Grund dessen, was die Medien über deren Privatleben schreiben.
Private Trivialitäten werden immer mehr zum Politischen und verdrängen das wirklich Politische.
Klein: Der beste Präsident dieses Jahrhunderts hatte eine Affäre, die seine Ehe zerstörte, er trank jeden Abend eine Flasche Martini, betrog beim Poker, macht dubiose Geschäfte und belog das Volk in Fragen wie Krieg und Frieden – mein Grossvater wählte ihn viermal; es war Franklin D. Roosevelt. Charakterliche Probleme können sich auch positiv auswirken. Affären sind Erfolgs-Indikatoren.
Gesprochen wird nicht über jede Affäre. Jene von George Bush war nur gerade 24 Stunden lang ein Thema.
Klein: Hat sie wirklich stattgefunden? Es waren vielleicht bloss Gerüchte.
Warum wissen wir so genau über Clintons Affären Bescheid?
Klein: Weil die Frauen, die redeten, dafür bezahlt wurden.
Wer wurde bezahlt?
Klein: Gennifer Flowers und Paula Jones.
Wenn Geld im Spiel war, dann hatte Hillary Clinton also Recht, als sie von Verschwörungstheorie sprach?
Klein: Es gab bestimmt eine breit angelegte Aktion von rechts gegen Clinton. Genau wie es einst eine breit angelegte Aktion von links gegen Nixon gab. In der US-Geschichte wiederholt sich ein Muster: Präsidenten, die Themen der oppositionellen Partei aufnehmen, werden oftmals von dieser Partei attackiert. Nixon war umweltfreundlich und setzte sich für die Sanierung der Innenstädte ein – zwei typisch demokratische Anliegen. Clinton hat republikanische Themen auf der Agenda. Plötzlich hat er da die eigene Partei und die Opposition als Gegner. Freunde hat Clinton keine.
Sie schrieben kaum über “Zippergate”. Warum hielten Sie sich zurück?
Klein: Während des Winters schrieb ich einen neuen Roman. Zudem widerte es mich an, wie meine Kollegen die Perspektive völlig verloren hatten. Sie realisierten nicht, dass sich in den USA etwas geändert hat: Sex schockiert nicht mehr.
Dann hat Clinton erreicht, woran die Sixties scheiterten: Die USA sexuell zu befreien?
Klein: Die Pille hat uns sexuell befreit.
Was macht Clinton so speziell?
Klein: Er ist ein grossartiger Politiker, und er liebt Menschen. Und er ist intelligent. Er ist der gescheiteste Mann, der mir je begegnet ist.
Sie waren der erste, der Clinton die Präsidentschaft zutraute. Ihr Roman wurde dann als Frustration gedeutet.
Klein: Das ist Unsinn.
Aber enttäuscht sind Sie?
Klein: Clinton könnte mehr erreichen. Vor allem jetzt, nachdem er die Wiederwahl gewonnen hat. Er steckt in der schwierigsten Lage, in die ein Politiker geraten kann: eine krisenlose Zeit. Machiavelli sagte, die grösste Gefahr für eine Republik sei anhaltender Frieden. Ein Land ist kaum mehr auf Trab zu halten. Das gelingt nur den Schweizern. Die tun ständig so, als herrsche Krieg.
Haben Sie seit “Primary Colors” mit Clinton gesprochen?
Klein: Ja.
Wie verlief das Gespräch?
Klein: Gut.
Was hält er vom Buch?
Klein: Das ist Privatsache, sorry.
Gabs keinen Hass?
Klein: Es gibt einige Indikatoren, die zeigen, dass Clinton mich nicht hasst. Er hätte mir alle Zugänge zum Weissen Haus verschliessen können. Ich rufe dort noch immer an, wen und wann ich will.
“Primary Colors” beschreibt das Sexleben des Präsidentschaftskandidaten von 1992 ziemlich genau. Woher kannten Sie all die Details?
Klein: Ich kenne keine Details.
Ihr Buch ist doch voller Insider-Informationen.
Klein: Alles ist erfunden, reine Fiktion.
Glauben Sie das wirklich?
Klein: Im Weissen Haus beschwerte sich niemand darüber, ich hätte verborgene Fakten ans Tageslicht gebracht. Die meisten Charaktere sind aus Leuten zusammengesetzt, die ich einst kannte. Da kommen alte Freundinnen von mir vor, Studienkollegen, Personen, die ich erfand. Oder gar Schauspielerinnen. Als ich Libby, die radikale Lesbe, schuf, hatte ich bereits Kathy Bates im Hinterkopf.
Waren Sie bei der Kinofassung von “Primary Colors” beteiligt?
Klein: Nur am Rande. Ich ass mit Regisseur Mike Nichols und Drehbuchautorin Elaine May ein paar Mal zu Mittag. Mit ihrer Arbeit bin ich sehr zufrieden.
Obwohl die Filmversion weniger Ecken und Kanten hat als Ihr Buch? Amerikanische Kritiker schrieben, die Filmer hätten vieles geglättet.
Klein: Drei Viertel der Dialoge im Film wurden aus dem Buch übernommen. Das kommt in Hollywood sonst nie vor.
Eine wichtige Szene aus dem Buch fehlt: Die Affäre der Präsidentenfrau mit dem Präsidentenberater. Das war dann doch zu viel fürs Kinopublikum?
Klein: Damit konnte ich leben. Schlimm wäre gewesen, wenn Henry Burton, die subjektive Erzählfigur, im Film weiss und nicht wie im Buch schwarz wäre.
Henry gleicht exakt dem Expräsidentenberater George Stephanopoulos, einem Sohn griechischer Einwanderer. Warum ist er hier schwarz?
Klein: Henry ist eine Kombination aus mir und Stephanopoulos. Ich kenne die schwarze Mittelklasse gut. Sie hat vieles gemeinsam mit Henry. Sie ist zwar Teil der US-Gesellschaft, steht aber trotzdem ausserhalb. Dadurch beobachtet sie die Dinge weitaus klarer als viele Weisse.
Henry war vielen zu weiss.
Klein: Der Vorwurf kam ausschliesslich von Weissen. Die Schwarzen gratulierten mir zur komplexen schwarzen Figur.
Ein Hit war der Film in den USA trotz begleitender Skandale nicht.
Klein: Vom Filmgeschäft verstehe ich nichts. Qualität war mir aber wichtiger als Kommerz. Im Vergleich etwa zu Tom Wolfes “Bonfire of the Vanities” bin ich ziemlich gut dran. Übrigens: Waren Sie schon mal in Cannes?
Ja.
Klein: Was trägt man dort?
Packen Sie den Smoking ein.