Interview: Peter Hossli

Frau Addario, Sie spürten Ihren ungeborenen Sohn erstmals kicken, als Sie über die Grenze nach Somalia reisten. Was haben Sie dabei gedacht?
Lynsey Addario: Für mich war das eine schwierige Zeit. Ich erlebte die Schwangerschaft als etwas Zwiespältiges, lange habe ich sie verdrängt. Ich wollte zwar eine Familie, aber es war mir schleierhaft, wie ich gleichzeitig Fotografin und ständig unterwegs sein konnte. Mir fehlten echte Vorbilder. Es gab keine andere Fotografin, die so wie ich arbeitete und eine Familie hat.
Wie gingen Sie mit dieser Ambivalenz um?
Indem ich einfach weiterarbeitete, an denselben Orten, wo ich normalerweise fotografierte.
Es gibt Leute, die Sie als leichtsinnig bezeichnen. Schliesslich ist Somalia eines der gefährlichsten Länder der Welt.
Wer das sagt, vergisst, dass Frauen in Somalia schwanger sind und jeden Tag Kinder zur Welt bringen. Warum kümmern die sich nicht um die schwangeren Frauen in Somalia, die unter diesen Umständen gebären?
Aber sind Sie denn leichtsinnig?
Nein, als das sehe ich mich nicht. Ich war vier Tage in Somalia und habe dort die Folgen der schweren Dürre fotografiert. Gefechte gab es keine.
Gleichwohl – Sie haben sich und Ihr Kind unnötigen Gefahren ausgesetzt.
Meine Schwangerschaft verlief problemlos, ich war sehr gesund. Statt wütend auf eine Journalistin zu sein, die vier Tage nach Somalia geht, sollten Sie sich auf die Frauen von Somalia konzentrieren!
Sie haben in Somalia kranke Kinder fotografiert. Diese brauchten einen Arzt. Was konnten Sie mit einer Kamera bewirken?
Schauen Sie, ich bin eine Journalistin! Ganz einfach. Ich habe keinerlei Probleme, kranke Menschen zu fotografieren. Zeige ich, wie es ihnen ergeht, dass Hunderte von Kindern an Unterernährung leiden, dann passiert etwas am von Dürre geplagten Horn von Afrika. Dann kommen die Hilfsorganisationen und unterstützen die Menschen. Mit der Kamera bin ich wirkungsvoll.
Journalismus ist nicht einfach nur ein Job. Die Arbeit definiert, wer wir sind. Was ist der Journalismus für Sie?
Ich mache das nicht wegen des Geldes, ich mache es, weil ich wirklich daran glaube. Die Menschen müssen sehen, was anderen in dieser Welt widerfährt. Wir müssen verstehen, warum und wo es humanitäre Krisen gibt, wo Menschenrechte verletzt werden, wo Krieg wütet. Es ist unsere Pflicht, sich diesen Themen anzunehmen – und uns zu fragen, wie wir helfen können.
Sie haben in Somalia ein Kind beim Sterben fotografiert und gleichzeitig Ihren Sohn in Ihrem Bauch gespürt. Was passiert da?
Es ist immer verheerend und traumatisch, ein Kind sterben zu sehen, ob man nun schwanger ist oder nicht. Es war einfach nur noch traumatischer, als ich schwanger war und meinen Sohn spürte. Aber ich bin viel lieber in Somalia mit meiner Kamera unterwegs und habe das Gefühl, etwas zu bewirken – als dass ich zu Hause sitze und beim Nichtstun mein privilegiertes Leben geniesse.
Heute sind Sie eine Mutter. Wie verändert dies Ihren Zugang zum Leid, das Sie abbilden?
Mein Verständnis ist noch schärfer geworden. Zuvor war ich schon mitfühlend. Stets habe ich versucht zu verstehen, was die Menschen durchmachen. Als Mutter kann ich nun die Bindung zu einem Kind wirklich verstehen und den unbändigen Trieb, es am Leben und gesund zu halten, dafür zu schauen, dass es sicher ist und alles erhält, was es braucht.

Ich gehe nicht mehr an die Front. Nach wie vor arbeite ich in Kriegsgebieten, ich arbeite im Irak und in Afghanistan, aber ich bin mehr im Hintergrund. Mein Fokus liegt auf der Zivilbevölkerung, derzeit begleite ich viele Flüchtlinge. Und ich versuche, etwas abseits der Schusslinie zu arbeiten.
Journalisten sind immer so gut wie ihre letzte Geschichte …
… natürlich …
… wie sehr fürchteten Sie sich, nicht mehr so gut zu sein als Mutter?
Oh, ich hatte schreckliche Angst. Ich war so zwiespältig, ein Kind zu kriegen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, weiterhin zu arbeiten und gleichzeitig eine Mutter zu sein. Ich wusste nicht, ob ich nach wie vor reisen konnte, ob ich meinen Sohn allein lassen könne. Als Erwachsene war mir immer nur etwas wichtig: meine Geschichten.
Ihre Arbeitshaltung ist beeindruckend. Was treibt Sie an?
Ich bürde mir sehr viel eigenen Druck auf. Meine Eltern arbeiten sehr hart, sie haben uns Kindern eine hohe Arbeitsethik mitgegeben. Meine Grosseltern sind Italiener, eine meiner Grossmütter kam von Süditalien über Ellis Island in die USA. Meine Grosseltern waren sehr arm, sie mussten sich alles hart erarbeiten. Von daher kommt wohl meine Arbeitshaltung.
Und wie kommen Sie zur Ruhe?
Keine Ahnung. Ich wünschte, ich wüsste es.
Viele Kriegsfotografen sind süchtig nach Adrenalin. Und Sie?
Halte ich mich im Krieg auf und schiesst jemand auf mich, dann spüre ich das Adrenalin schon. Das passiert allen. Es ist eine natürliche Erscheinung des Kriegs. Aber mich interessieren die Geschichten weit mehr, die Orte, wo ich Geschichten erzähle. Ich sehe mich als Briefträgerin, die schildert, was passiert. Das treibt mich an. Adrenalin ist bei Kampfhandlungen präsent, aber diese machen höchstens fünf Prozent von dem aus, was ich mache.

… mich verwirrt die Bezeichnung Kriegsfotografin. Zumal ich wirklich keine gute Fotografin von Gefechten bin. Zwar habe ich oft in Kriegszonen gearbeitet. Aber in erster Linie erzähle ich Geschichten von Zivilisten in Krisengebieten.
Warum mögen Sie den Begriff Kriegsfotografin nicht?
Weil er nicht zu mir passt. Es gibt viele Fotografen, die ausschliesslich Kriege fotografieren. Zu denen gehöre ich nicht. Selbst wenn ich mich in einem Kriegsgebiet aufhalte, liegt mein Fokus selten auf den Kampfhandlungen.
Gibt es irgendwo eine Tragödie, sind Sie sofort dort. Ist das nicht eine Sucht?
Nein, ich denke, es ist eine Berufung. Ich glaube an meinen Beruf, und ich sehe, was ich bewirke. Ich zeige Menschen, wie sie helfen. Regierungen reagieren auf meine Bilder. Und wenn ich das alles sehe, kann ich nicht mehr aufhören. Dabei geht es mir nicht ums Abenteuer. Ich bin ja keine Draufgängerin. Mich frustriert es sehr, wenn Sie das Wort Sucht verwenden. Das ist so oberflächlich. Es wertet Menschen ab, die ihr Leben etwas Wichtigem verschrieben haben.
Fotograf Robert Frank sagte mir einst, dass früher die Menschen eher bereit waren, für ein Foto hinzustehen. Heute sei das schwierig. Wie erhalten Sie das Vertrauen?
Auf Reportagen nehme ich mir wirklich Zeit, mit den Menschen zu reden, ihnen zu erklären, warum ich dort bin, warum ich denke, es sei wichtig, ihre Geschichte zu erzählen. Es dauert eine Weile, bis ich anfange zu fotografieren. Wenn ich beginne, fühlen sich die Menschen wohl und verstehen, was mich interessiert. Letzte Woche war ich in Indien und habe eine Frauenklinik fotografiert. Es war eine sehr intime Geschichte. Zuvor habe ich einfach mit den Frauen gesprochen, bin rumgestanden. Es ist nicht meine Art, einfach mit der Kamera vor Gesichtern herumzufuchteln.

In einem Kriegsgebiet spielt es keine Rolle, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Alles passiert sehr schnell, und es ist nur eine Frage, was du suchst und wie rasch du reagieren kannst.
Sie arbeiten oft in islamischen Ländern. Wie schwierig ist das als Frau?
Fotografiere ich eine Reportage in der islamischen Welt, ist es ein riesiger Vorteil, eine Frau zu sein. Das sind nach Geschlechtern getrennte Gesellschaften. Als Frau habe ich im Islam hervorragenden Zugang zur Welt der Frauen.
Sie sind im Irak und später in Libyen entführt worden. Wer trägt die Schuld?
Schuld bin allein ich. Ich wusste ja, auf was ich mich einlasse. Wer über Krieg berichtet, setzt sich Gefahren aus. Wir Journalisten akzeptieren, dass etwas passieren kann, vor allem in Libyen. Ich bin dankbar, noch immer am Leben zu sein.
Sie fühlten sich schuldig, weil die entführten Männer schlechter behandelt wurden als Sie. Warum?
Meine Kollegen schrien, weil die Entführer sie mit Gewehrkolben schlugen. Sie verschonten mich – allein weil ich eine Frau bin. Als ich die Schreie der Männer hörte, dachte ich, das sei nicht fair.
Sie sind an intimen Stellen betatscht worden. War das nicht schrecklich?
Doch, natürlich war es widerlich und schrecklich. Vor allem hatte ich ungeheuerliche Angst, vergewaltigt zu werden. Aber ich hörte meine Kollegen, und ich spürte, ich werde anders behandelt, weil ich eine Frau bin. Dafür schämte ich mich.
Sie wurden nicht vergewaltigt. Wissen Sie heute warum?
Zum einen, weil ich glücklicherweise nicht von meinen drei männlichen Kollegen getrennt wurde. Eines Nachts kam ein Kerl in unsere Zelle. Wir alle waren eingeschlafen. Aber ich hörte die Türe scheppern. Er fasste meinen Fuss und versuchte, mich aus dem Raum zu zerren. Dann habe ich mich einfach an Anthony Shadid geklammert, kuschelte mich an ihn, als wäre er mein Ehemann. Ich sagte einfach: «Anthony.» Der Typ hat uns angeschaut – und verschwand.
Sie haben eine Frau fotografiert, die von neun Männern vergewaltigt worden war. Wie können Sie mit solchem Leid umgehen?
Durch meine Arbeit! Und indem ich meine Fotos der ganzen Welt zeige. Es geht ja nicht darum, was für schreckliche Dinge ich erlebe. Es geht darum, dass ich den Menschen helfe, die ich fotografiere.
Sie haben nicht nur Gewalt gesehen, Sie haben Böses gesehen. Wie hat das Ihr Verständnis von uns Menschen beeinflusst?
All diese Dinge erlebe ich ja nicht in einem Vakuum. Sie begleiten mich überall und immer. Ich habe gesehen, zu was Menschen fähig sind: zu bösartigster, aggressivster Gewalt. Und dass Menschen das genaue Gegenteil sein können: wunderbare und grossherzige Wesen.
Wie wichtig ist es für Sie, in einem Konflikt neutral zu bleiben?
Es bedeutet mir alles. Es ist meine Aufgabe, zu dokumentieren, was ich sehe, und es öffentlich zu machen. Natürlich habe ich eine eigene Meinung, aber mir ist egal, wie jene denken, die ich fotografiere. Ich interviewe, ich fotografiere, und ich gebe das Material der «New York Times» oder «National Geographic».

Es trifft mich enorm. Nicht nur weil ich Mutter geworden bin, sondern weil befreundete Fotografen bei der Arbeit starben, berichte ich heute seltener direkt vom Schlachtfeld. Ich möchte diesen Job weiterhin ausüben, aber ich muss für mich andere Grenzen setzen, und ich muss herausfinden, wie ich weiter gut arbeiten und gleichzeitig am Leben bleiben kann.
Wie bleiben Sie am Leben, wenn Sie beschossen werden?
Ich bin die Erste, die flach auf dem Boden liegt und ein Versteck sucht. Meine Fotos von Gefechten sind nicht sehr gut – weil ich gar nicht so viele Fotos davon mache.
Aber wie schaffen Sie es, am Leben zu bleiben?
Glück gehört sicher dazu. Ebenso wichtig ist es, möglichst schnell in Deckung zu gehen, unten zu bleiben. Dank meiner Erfahrung weiss ich mittlerweile, wie ich mich ver-halten muss, um zu überleben.
Welche Risiken gehen Sie für ein gutes Bild ein?
Mein erstes Ziel ist es zu überleben. Denn wenn ich tot bin, kann ich nichts mehr tun. Deshalb versuche ich immer, zuerst in Deckung zu gehen, etwa hinter einer Wand oder einem Felsen. Von dieser Position aus fotografiere ich. Finde ich keine Deckung, verschwinde ich.
Warum berichten die Medien mehr über den Tod von Journalisten als von Zivilisten?
Das ist sehr traurig, denn ein Leben ist ein Leben. Es darf keine Rolle spielen, ob eine Journalistin oder ein Zivilist stirbt. Es ist immer schrecklich, Menschen zu verlieren. Persönlich trifft es mich mehr, wenn ein Journalist stirbt, denn wir alle sind irgendwie eine grosse Familie. Journalisten leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft, und Journalisten müssen als neutrale Beobachter respektiert werden. Sie dürfen nicht beschossen werden.
Warum schreiben Sie in Ihren Memoiren über Ihr Liebesleben?
Ursprünglich wollte ich das gar nicht. Meine Lektorin beim Penguin-Verlag ermutigte mich aber dazu. Zumal sie der Ansicht ist, es sei sehr schwierig, mit diesem Job ein normales Leben zu führen.
Sie hat recht.
Aber ich hatte Angst, wenn ich zu viel über mein Privatleben schreibe, untergrabe ich meine Arbeit. Mir ist jedoch klar: Es hilft zu verstehen, wie schwierig man als Fotojournalistin ein normales Leben führen kann. Du musst vor Ort sein. Sobald etwas passiert, musst du ins Flugzeug steigen. Du musst deinen Geliebten während eines Abendessens verlassen. Du verpasst die Geburtstage und Hochzeiten deiner besten Freunde. Du bist für Momente nicht da, die anderen wichtig sind. Nur wenige können das verstehen. Und genau das wollte ich beschreiben. Ich wollte aufzeigen, welch riesige Opfer wir bringen.
Ihr Freund hat Sie betrogen, als Sie weg waren. Sie akzeptierten es – weil Sie ihn mit Ihrer Arbeit betrogen?
Damals habe ich das noch nicht so klar gesehen. Ich war verliebt, und mein Herz blutete. Wie kann das nur passieren?, fragte ich mich. Ich liebe diesen Mann, warum versteht er mich nicht? Ich liebe ihn, und ich muss doch für meinen Job weg. Heute verstehe ich, dass man jemanden nicht zwei, drei Monate verlassen kann – und dann davon ausgeht, dass er das einfach so hinnimmt. Du bekommst von einer Beziehung zurück, was du reinsteckst. Mir ist dann irgendwann klar geworden: Ich konnte keine Geschichte verpassen, nur weil ich zu Hause die gute Freundin sein sollte.

Für mich war das wie ein Gedicht! Ich dachte, meint der es wirklich ernst? Ist er real? Paul war sehr lange selber ein Journalist. Er war 16 Jahre bei Reuters. Er versteht einfach, was ich mache. Er arbeitet genauso leidenschaftlich wie ich, er unterstützt mich, und er fühlt sich von meiner Hingabe zu meiner Arbeit nicht bedroht. Und das ist etwas vom Wichtigsten in einer Beziehung. Wir sind echte Partner. Wir verstehen einander, wir respektieren einander, und wir beide wissen, dass unsere Leidenschaft für unsere Arbeit nichts von unserer Beziehung wegnimmt.
Ihre Familie und Ihre Angehörigen sind ständig auf Nadeln, wenn Sie in gefährlichen Regionen unterwegs sind. Ist das nicht sehr egoistisch?
Es ist ein selbstbezogener Beruf, und ja, es ist schwierig für unsere Liebsten. Ich weiss das. Aber die Welt hat sich längst verändert. Paris und London sind heute nicht mehr einfach sicherer als andere Orte. Terroristen nehmen diese Städte genauso ins Visier.
Einer Ihrer entführten Kollegen sagte, er halte das nicht mehr aus, er höre auf. Waren Sie jemals an diesem Punkt?
Nein. Aber wir alle wussten nach der Entführung in Libyen, dass es schwierig sein würde weiterzumachen. Mir war klar, ich muss ein bisschen kürzertreten. Und ich muss herausfinden, wie es nun weitergeht. Ans Aufgeben habe ich aber nie gedacht. Das passt nicht zu mir.
Welche Geschichte hat Ihnen am meisten Genugtuung gebracht?
Es gibt diese Geschichte nicht. Irgendwie bin ich nie zufrieden mit meiner Arbeit. Ständig denke ich, ich hätte versagt.
Wann wussten Sie, dass Ihr Leben spannend genug ist für ein ganzes Buch?
Das war mir nie bewusst. Bis heute bin ich ein bisschen schockiert, dass die Leute mein Buch lesen wollen. Nach Libyen wollte ich ein Fotobuch machen. Dann starben meine Kollegen Tim Hetherington und Chris Hondros. Das hat mich aus der Bahn geworfen. Danach konnte ich kein Fotobuch mehr herausgeben. Nach Libyen kontaktierten mich viele
Literaturagenten. Sie meinten, es gebe wenige Frauen, die machen, was ich mache – und ich soll darüber schreiben.
Steven Spielberg hat die Rechte an Ihrem Buch gekauft.
Falsch. Steven Spielberg hat die Rechte nicht gekauft. Warner Brothers hat eine Option am Buch erstanden.
Klar ist aber: Jetzt sind Sie die Geschichte.
Sicher, Spielberg und Jennifer Lawrence sind interessiert. Aber das ist Hollywood. Alles kann noch schiefgehen zwischen jetzt und dem Dreh. Es gibt noch kein Drehbuch. Natürlich fühle ich mich geehrt. Vor allem freut es mich, weil es um Dinge geht, die mir so sehr am Herzen liegen. Der Film könnte viele aufrütteln. Denn die Menschen schauen sich Hollywood-Filme an. Hollywood ist eine weitere Plattform, über jene Dinge zu reden, die mir und meinen Kollegen so wichtig sind.
Letzte Frage: Was ist Ihnen heute wichtiger, die Liebe oder Ihre Arbeit?
Sie meinen jetzt? Jetzt? Das ist eine wirklich schwierige Frage. Da ich älter werde – vielleicht, ähm, also ehrlich: Ich weiss es wirklich nicht. Ich kann es wirklich nicht beantworten. Hätten Sie mich das vor zehn Jahren gefragt, hätte ich mit der Antwort nicht gezögert. Aber jetzt kann ich Ihnen wirklich keine abschliessende Antwort geben.
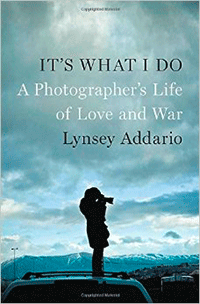
Im März 2011 fotografierte Lynsey Addario den Arabischen Frühling in Libyen. Dabei wurden sie und drei Kollegen entführt. Nach der Freilassung schrieb sie ihr Leben nieder. Nun publizierte sie ihre berührende Autobiografie «It’s What I Do: A Photographer’s Life of Love and War». Es ist ein hervorragendes Buch über Journalismus geworden. Packend schildert Addario, wie sie behütet in Connecticut aufwuchs, in Argentinien und auf Kuba zur Fotografie kam – und leidenschaftlich ihren Beruf ausübt. Noch vor 9/11 fotografierte sie in Afghanistan. Später ging sie zurück, fotografierte den Krieg im Irak, hielt Grausamkeiten im Kongo fest, zeigte Hunger in Somalia. Persönlich und ehrlich beschreibt Addario, wie schwierig es für sie ist, neben dem Beruf echte Beziehungen zu leben.
Das Hollywood-Studio Warner Bros. hat die Rechte an Addarios Auto-biografie erworben. Steven Spielberg soll bei der Verfilmung Regie führen, und Jennifer Lawrence («The Hunger Games») ist als Hauptdarstellerin vorgesehen. Ein Drehbuch gibt es noch nicht.
Fotos: Kursat Bayhan, Lynsey Addario
