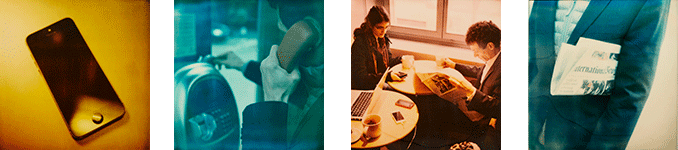Von Peter Hossli (Text) und Gerry Nitsch (Polaroid-Fotos)

Das Postfach ist geleert, jedes Mail beantwortet, die Termine fixiert und auf Zetteln notiert. Eine Taschenlampe liegt auf dem Nachttisch, ein Wecker, dazu ein Kompass. Eine Karte der Stadt Zürich ist gekauft. Gibt es eigentlich das Kursbuch der SBB noch?
Dann – es ist Samstagabend nach der Arbeit – aktiviere ich die Abwesenheitsnotiz:
Vielen Dank für Ihr Mail. Leider kann ich es derzeit nicht lesen. Bis am 6. Februar bin ich offline. Sie können mich per Fax erreichen unter der Nummer +41 44 259 86 42; und zu Bürozeiten über den Festnetzanschluss.
Ob heute noch jemand weiss, wie man einen Fax verschickt?
Eine letzte Meldung auf Twitter geht online: «Offline.»
Um Mitternacht ist Schluss, mein iPhone schwarz, das WLAN beim Laptop deaktiviert. Das Netz – weg.
Ein erster Gedanke: Verloren.
Seit 1994 bin ich online. An der New York University erhielt ich –damals 25-jährig – eine erste Mail-Adresse. An der Universität Zürich brauchte es dafür einen begründeten Antrag. Etwa: «Um den Professor in New York rasch zu erreichen.» Dieser Satz genügte.

Anfang 1995, vor dem Start des Magazins «Facts», schlug ich die Kolumne «E-Mail» vor. «Was ist das?», fragte der Chefredaktor. Für «Facts» entwickelte ich die Website, hatte bald eine eigene. Ja, ich stand in der Schlange in Brooklyn, um das erste iPhone zu kaufen.
Mein Handy ist das Letzte, was ich nachts loslasse, und das Erste, was ich morgens berühre. Damit führe ich jedes Telefongespräch. Auf fünf Adressen erhalte ich Mails.
Und jetzt – erstmals seit 21 Jahren – lese ich während sechs Tagen keine elektronischen Nachrichten, lasse Twitter allein, ist das iPhone immer aus. Geht das?
Kaum, so der Sonntagmorgen. Der erste Blick gehört zwar dem blauen Himmel. Und der erste Gedanke? Gehört Twitter!
Was hat der Newsmän gepostet, dieses Phantom, das auf Twitter die guten Artikel der Sonntagszeitungen verlinkt? Kommentiert jemand meinen Text über das geschundene Tessin? Was passiert auf der Welt? Rufe den Kollegen an. «Schreibt
einer zum Tessin?» – «Ja.» – «Was denn?» Er liest zwei Tweets vor.
Tatsächlich? Lasse ich mir wirklich das Internet vorlesen? Erbärmlich, denke ich, wie ein Alkoholiker, der heimlich Rasierwasser trinkt.
Es ist noch nicht einmal Mittag, und ich denke schon an den Ausstieg vom Ausstieg, lüstere nach einem Klick. Doch nichts piepst, kein digitaler Impuls schiesst ins Gehirn. Was ermüdet. Weder Bytes noch Bites regen die Synapsen an.

Dann aber, am Abend, erwachen andere Sinne. Die Augen verfolgen tanzende Schneeflocken, alles riecht intensiver. Die Ohren hören Sätze klipp und klar. Der Fokus liegt auf einer einzigen Sache. Multitasking? Passé.
Es ist Montag, die Ruhe hat sich früher eingestellt als befürchtet. Der Fluss der Nachrichten, dieses unbändige Monster aus oft unnötiger Aufregung, zieht unbemerkt vorbei. Was passiert auf der Welt? «Keine Ahnung!»
Gedruckte Zeitungen bringen vor allem Hintergrund, Radiostationen überraschend viel Abseitiges. Was zählt, rede ich mir ein, steht ohnehin nicht im Internet. Die Familie ist gesund, die Töchter schreiben gute Noten, bei der Schlägerei an der Schule hat sich keiner ernsthaft verletzt.
Doch wie spät ist es? Am Handgelenk mag ich keine Fesseln, also klaue ich die Zeit an der Kirche, im Zug, beim Bahnhof, von der Frau am Nebentisch. «Was starren Sie so?», faucht sie auf Englisch. Eine Amerikanerin. «Wollte nur die Zeit auf Ihrer Uhr ablesen.» – «Oh, haben Sie denn kein Handy?» Meine selbst auferlegte Abstinenz fasziniert sie, das sei ja «cute», sagt sie, so herzig. Es beginnt ein Flirt, der etwas länger dauert als die geplante Pause. Fürs nächste Treffen bin ich wohl zu spät. Sollte sofort telefonieren – aber wie?
Beim Zürcher Opernhaus steht eine Telefonzelle. 60 Rappen kostet ein Anruf. Doch wie lautet die Nummer der Beiz, wo ich hinmuss?
Telefonbücher hat es in der Zelle keine, die 111 gibt es offenbar nicht mehr. Die neue Auskunft – 1811 – kostet in der Kabine 3.50 Franken. Dafür surft das iPhone drei Tage lang. Dann komme ich halt zu spät.

Offline entspannt – mich. Ein Téte-à-Téte – «schreibt man das so, wer hat einen Duden?» –, also ein Tête-à-Tête ist nun ein Gespräch zwischen mir und einem Gegenüber, das ein bisschen bei mir ist, aber auch dort, hier und überall. Das immer wieder auf den Screen äugt, dann ein SMS schreibt, einen Anruf entgegennimmt – «sorry, darf ich nur ganz kurz?» –, erneut ein Surren in seiner Hose spürt – «das nehme ich jetzt aber nicht» – und dann doch fragt: «Wo waren wir eben?»
Ein Zombie, denke ich.
Wer offline geht, dem fallen sie überall auf, die Zombies unter uns. Sie sitzen im Tram, der Kopf geneigt, starr der Blick auf Facebook. Sie verschlingen die irren Schlagzeilen der Newsportale, gehen tippend übers Trottoir. In Sitzungen halten sie ihr Gerät in der Hand, streicheln es, statt zu denken. Mit Musik im Ohr kapseln sie sich ab.
Als liefe ich im Spiegelsaal: Ich war genau gleich, damals online.
Aber jetzt bin ich offline, und das tut dem Selbstwertgefühl gut. Die anderen sind die Gefangenen, ich der Freie. Geht es so dem Banker, der zum Kiffen nach Goa fliegt?
Das Leben ist nun voller Zeit. Das ganze «Folio» zu Wunderkindern gelesen, statt auf den Salontisch gelegt, dazu den «Spiegel» und in der «Schweizer Illustrierten» das Porträt eines Schweizers, der ein Gefangener in Auschwitz war. Da bleibt weit mehr hängen als von Tweets.
Die Töchter lachen schallend. «Du blätterst nach dem Essen in der Zeitung? Ist ja mega», bemerkt die grosse. «Sonst schaust du soooo aufs Handy», sagt die kleine, äfft die Haltung nach, mit der Erwachsene ihr iPhone verehren. Gnadenlos führt sie vor, wie lächerlich wir wirken, wenn Bloomberg News uns näher ist als das eigene Kind.

Dann im Tram die erste Begegnung mit Nachrichten: «Smartphones machen Jugendliche depressiv», titelt «20 Minuten». Basler Forscher schlagen Alarm. Kinder sind müde, können sich nicht konzentrieren, leisten wenig, wenn sie viel chatten.
Und was leiste ich, offline? Wenig. Sage Artikel ab, kann kaum recherchieren. Finde nicht mal eine Telefonnummer. Dafür flutscht es beim Schreiben. Kein Push alarmiert. Nie zittert die Hosentasche. Kein Mail lenkt ab. Schnarrt, johlt, gluckst oder japst es im Grossraumbüro, geht das andere an. Kollegen drucken mir Texte aus, bringen sie vorbei, palavern, statt Mails zu schicken. Bin ich nicht am Pult, hinterlassen sie handgeschriebene Zettel. Cute. Per Lift hole ich im vierten Stock eine Kontaktadresse ab. Drei Frauen reden über mein Experiment. Als wären sie gerne selbst mal ohne, und die Männer würden sie statt ihr Smartphone anschauen.
Das Mobiltelefon des Sitznachbarn klingelt. Es ist Pascal, ein guter Freund. «Ja, der Peter ist hier, er ruft dich vom Festnetz zurück.»
Pascal besitzt eine von drei Telefonnummern, die ich auswendig kenne. «Du beantwortest kein SMS, dein Telefon ist aus, mache mir Sorgen.» – «Bin offline.» – «Warum sagst du nichts?» – «Es steht auf Twitter.»

Im Offline-Leben sind Termine verbindlich: Du holst die Kinder heute nach der Schule ab, ich morgen. Meine Frau und ich treffen uns genau dann und dort. Verschieben im letzten Moment? Liegt nicht drin.
Doch wie schaffe ich eine Reise? Wie komme ich von Zürich-Stadelhofen zeitig nach Zug, ohne App der SBB? «Ja, es gibt das Kursbuch noch», sagte die Frau am Schalter. «Brauchen Sie eine Tragtasche?» – «Wozu?» – «Es ist schwer und gross.» Sie klaubt drei dicke Bücher aus einem Kasten, dreht eines nach dem anderen durch die Schleuse: «16 Franken.» Damit den richtigen Anschluss finden? Dazu brauchts einen Ingenieur.
Viele Fragen bleiben ohne Antwort. Hat Schauspieler Michael Keaton schon mal einen Oscar gewonnen? Was machen DAX und Dow? Euro und Dollar? Die Gelassenheit im Ressort Wirtschaft spricht für ruhige Börsen. «Wir haben heute gesehen, was das Erdöl macht», sagt eine Rohstoff-Händlerin später in Zug.
Ja, was macht das Erdöl? Der Öl-preis muss warten, bis zur Zeitung am nächsten Morgen. Darin finde ich erstmals wieder Neues. Etwa: Wie frostig es ist. Dass Widmer-Schlumpf über Europa abstimmen lassen will. Lara Gut nicht gut Ski fährt. Zeitungsmacher stellen all das für mich zusammen. Sie geben mir weniger als das Internet, aber bei ihnen ist es aufgeräumter.
Am Tag fünf sehe ich nur noch Versuchungen. Wie ein Hungerkünstler, der sich im Schlaraffenland verirrt hat. Bars werben mit Bier und Free WiFi. Der Apple Store lockt mit glitzernden Dingen, die alle in die Datenbahn führen. Ich schaue weg.
Am Nachmittag eine echte Krise. Ein Chefredaktor klagt: «So kannst du gar nicht für uns arbeiten.» Aber ich arbeite doch, spanne den Kollegen für Recherchen ein, schicke ihn ins Internet und lasse Artikel über die SVP und den Schuhschnabel ausdrucken. Das ist seltsam, denke ich. Es gibt diese Kategorien doch gar nicht: Offline, online. Heute ist alles im Netz.

Doch das wäre ein Beschiss an Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser. Wie ein erfundenes Zitat, wie ein abgeschriebener Satz. Die journalistische Haltung rettet mich vor dem Absturz – wie die Intervention einen Junkie.
Eine Ewigkeit scheint seit dem Ausstieg vergangen. Damals, am verteufelten Sonntag, stand im Kopf der letzte Satz dieses Textes bereits fest: «Nie mehr offline.»Am zweiten Tag, mit dem tanzenden Schnee im Auge, kippt es. Oh, wie befreiend!
Es wurde besser. Will ich jemals zurück? Wieder ein Sklave sein?
Und jetzt, vor der Rückkehr? Offline arbeiten geht nicht. Wer nicht online ist, existiert nicht – und das ist durchaus empfehlenswert.
Übrigens: Einen Fax erhielt ich in dieser Woche nicht.
Digitaler Stau: Das hat er offline verpasst
Seit Freitag, 6. Februar, kurz vor 12 Uhr ist unser Autor Peter Hossli wieder online. Das hat sich in seiner digitalen Auszeit angesammelt:
342
… Mails flutschen in sein Postfach. Wichtig waren nur deren fünf. Die anderen sind längst gelöscht.
10
… neue Follower auf Twitter – einer hat seine Tweets besonders vermisst: «Gehts Ihnen gut?», fragt er per DM.
28
… Artikel der «New York Times», die er gerne gelesen hätte. Darunter eine Analyse, weshalb Google Glass floppt.
28
… verpasste Anrufe, dazu 36 SMS. Eines berührt: «Bitte gib ein kurzes Lebenszeichen, ich mache mir Sorgen.»