Von Peter Hossli (Text) und Robert Huber (Fotos)
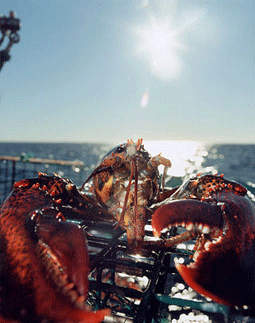
Allerdings: Die Todesfurcht, die die krustigen Meeresviecher offenbar befallen hat, ist für einmal für die Katz. Anderson wirft zurück, was er eben an Bord gezogen hat. «Lucky lobsters», glückliche Hummer, scherzt der Lobsterman, wie die Hummerfischer hier in Maine heissen. Zwei der Tiere waren gross gewachsene und deshalb besonders paarungsfreudige Männchen. Die drei Weibchen in der Falle trugen tausende dunkelrote Rogen an den Bäuchen. «Sie sichern die Zukunft», begründet der 42-jährige Anderson seine Gnade vor dem Frühstück.
Die Barmherzigkeit ist freiwillig und eine der vielen Massnahmen, die ein weit gehend ungeklärtes Phänomen begründen: den Hummerboom vor der zerklüfteten Küste im nordöstlichen US-Bundesstaat Maine.
Weltweit nehmen die Fischfangerträge ab, und Biologen warnen vor dem irreversiblen Raubbau am Meer. Ganz anders die Situation in Maine: Hier gibt es seit Jahren steile Zuwachsraten. Sind die edlen Krebse etwa vor New York fast ganz ausgestorben und beschränken die Kanadier ihre Fangperiode auf zwölf Wochen jährlich, wird in Maine pausenlos gefischt – und trotzdem wächst die «Ernte» der begehrten Köstlichkeit permanent, während die Wissenschaftler seit 25 Jahren vor dem baldigen Kollaps warnen.
Rund 24’000 Tonnen Hummer haben die rund 7500 lizenzierten Fischer im Jahr 2000 in Maine an Land gebracht, in blaue Kisten verpackt und lebend an Feinschmeckerlokale in aller Welt verkauft. 1990 waren es noch 11’300 Tonnen gewesen. 2001 allerdings wird kein neues Rekordjahr werden. Die Nachfrage nach dem Luxusgut Hummer nahm nach der Terrorattacke vom 11. September ab.
Dwight Rogers amtet als Vorsteher der Lobster-Co-op von Corea, einem Hafenstädtchen mitten im fruchtbaren Hummerrevier im Norden Maines. Weder Hotels noch Restaurants stören die beinahe kitschige Idylle. Eine eigenwillige Posthalterin benannte das fast vollständig von Wasser umgebene Kaff einst nach der koreanischen Halbinsel. Vor 30 Jahren schlossen sich die Fischer von Corea zu einer Kooperative zusammen. Seither verkaufen sie ihre Fänge direkt an Exporteure und teilen sich Ende Jahr den Gewinn.
Gegen 800 Pfund beträgt die Tagesausbeute eines Fischers
Der fällt nicht zu knapp aus. Pro Pfund (453 Gramm) gibts im Sommer 3.25 Dollar, im Spätherbst 4.50 Dollar, denn die Festtage am Jahresende sind die Hummer-Hauptsaison. An guten Tagen fängt ein tüchtiger Fischer schon mal 800 Pfund – das sind rund 360 Kilogramm. Nicht wenige der Coreaner erzielen Jahresumsätze von 200’000 Dollar. Die Region prosperiert. Grosse Geländewagen kreuzen auf den engen Strassen. Grosse, schnelle und mit Hightech voll gestopfte Schiffe ankern.
Kaum sind die Hummer entladen, gewogen und sortiert, beginnt in Corea die Vorbereitung für den nächsten Tag. Zwei Angestellte der Co-op füllen Dieselöl in die Boote. Sie schaufeln Heringe in Plastikkübel und heben die stinkende Fracht mit einem simplen Kran in die leeren Ködertruhen. Abgerechnet wird mit Quittungen und spitzen Stiften.
«Die Fischer verdienen am meisten», sagt Rogers, Geschäftsführer der Kooperative, die inzwischen 42 Aktien besitzende Mitglieder zählt, 41 Männer und eine Frau. Der Jüngste ist 14, der Älteste 85, ein Viertel über 60 Jahre alt. «Je weiter die Ware vom Atlantik entfernt ist, desto geringer fallen die Margen aus», erklärt der vife Vorsteher das globale Geschäft.
Um fünf Uhr früh läuft Randy Anderson am nächsten Morgen erneut aus. Er fischt gerne weit draussen, eine gute Stunde von der Küste entfernt. Warum? «Ich traue dem Instinkt», sagt Anderson, der mit 14 zu fischen anfing. Es gebe kein Rezept. Ein guter Fischer ahne, wo Hummer hocken. «Ein sehr guter weiss es.»
Unmittelbar vor der Küste ist das Meer fünf bis zehn Meter, hier draussen aber bis zu 80 Meter tief. Entsprechend weit hinab müssen die Reusen gehängt werden, um die auf dem felsigen Grund krabbelnden Achtfüsser einzufangen.
Derek Crocker, Andersons «Sternman» oder Gehilfe, füllt Ködersäcke nach und hängt sie in die hochgezogenen und leeren Reusen. Eine Zigarre glimmt zwischen seinen Lippen. Die Arbeit fordert körperlich, und sie ist monoton. Crocker packt die Lobster und bindet ihre Klauen mit Gummibändern zu. Dann setzt er die Fallen erneut aus. Dreihundertmal, Tag für Tag, wiederholt sich die Prozedur.
Kein besonders gesunder Job. Verletzungen sind häufig. Es kommt vor, dass einer einen Arm verliert, wenn er sich in einem Seil verfängt. Viele beklagen Knochenschwund. Oder Hautkrebs, das Meer reflektiert und verstärkt das gleissende Sonnenlicht. «Kein Wunder, gaben die Jünger, alles Fischer, ihre angestammte Tätigkeit auf», witzelt einer, «Jesus bot ihnen etwas Besseres.»
Der Hummer ist in Maine eine Touristenattraktion
Nichtsdestotrotz denkt keiner ans Aufhören. Manch einer stirbt alt, alle Reusen ausgelegt. «Ja», sagt Raymond Dunbar Jr. am Sonntag nach dem Kirchgang, «ich fahre regelmässig raus.» Er ist 85 und fischt seit 60 Jahren. Den freiheitlichen Lebenswandel mag er nicht aufgeben. Zudem ist der alteingesessene Coreaner stolz auf das heimische Produkt, das er fängt. «In Maine gibts die besten Hummer der Welt», sagt Dunbar. «Sie schmecken hervorragend und überleben länger als die anderen.»
Tatsächlich ist das Wasser hier kühler und sauberer als sonstwo im Nordatlantik. Zwar trifft man den delikaten und schmackhaften homarus americanus von Virginia bis Neufundland, jedoch nirgends so zahlreich wie in Maine.
Das mit der Kakerlake verwandte Viech ist in Maine eine Touristenattraktion. Weltweit lassen die Fischer «Lobster from Maine» als Markenprodukt propagieren – und damit für ihre Region werben. Lokale McDonald’s-Restaurants bieten mit Hummerfleisch gefüllte Sandwiches an. Rustikale Beizen lassen Gäste das lebende Tier auswählen, das sie eine Viertelstunde später verspeisen können. Am Flughafen von Bangor kann man Hummer in Kartonschachteln verpackt erstehen und als lebendiges Handgepäck mitnehmen. Zudem bemühen sich einzelne Hummerhändler, ein anerkanntes Gütesiegel für «organic Maine Lobster» einzuführen – als Gegenwicht zur kanadischen Ware, die nicht selten mit Antibiotika geimpft ist.
Nicht immer galt das Krustentier als Delikatesse: Die in Maine lebenden Abnaki-Indianer warfen es Anfang des 19. Jahrhunderts noch als Dünger auf ihre Felder.
Junge Hummer eigneten sich dazu besonders gut. Wie Schlangen legen sie ihre Schale ab, damit sie wachsen können. Babys mehrmals und Erwachsene einmal jährlich – das Weibchen kann sich nur so paaren. Ungeschützt krabbeln die Viecher dann auf dem Meeresgrund herum. Damit die Schale rasch nachwächst, müssen sie viel fressen. Deshalb laufen weiche Hummer häufiger in die mit Köder voll gestopften Fallen.
Weichschalige Hummer können aber nicht über längere Strecken transportiert werden. Also legt man sie vorerst in Lobster-Ponds, künstlich angelegte Teiche. Dort werden sie gefüttert, bis die Schale fest ist. Randy Anderson vergleicht das Verfahren mit der Börse. «Sind die Preise niedrig, halten wir die Weichen in den Teichen zurück, steigen sie, verkaufen wir die harten Tiere.»
Der Hummer – er ist das wahre Märchen einer sonst trüben Realität. Riesige Fangnetze haben global die Bestände der Meeresbewohner dezimiert. Der Kaviarfisch Stör im Kaspischen Meer, die Königskrabbe in Alaska, der «Fish-and-Chips»-Lieferant Kabeljau vor der US-Ostküste oder die Makrele in der Nordsee – wo immer eine einzelne Fischart gezielt gejagt wird, droht deren Aussterben. Nur nicht hier in Maine. «Keiner kennt den wahren Grund dafür», sagt Rogers.
Ein toter Hummer ist ein wertloser Hummer
Dabei hat der technologische Wandel die Chancen der Hummer merklich verringert. Metallreusen haben die hölzernen Fallen abgelöst und die Lebensdauer der Fanggeräte verlängert. Mit immer grösseren und schnelleren Booten machen sich die Jäger allmorgendlich auf die Pirsch. Satellitengesteuerte Navigationscomputer finden die Tage zuvor auf offener See ausgelegten Fallen auch im Nebel. Nicht mehr kräftige Arme, sondern mit Motoren betriebene Seilwinden ziehen die schweren Eisengitter hoch, was die Fangfrequenz markant erhöht.
Die Nachfrage nach Hummer ist im letzten Jahrzehnt enorm gestiegen. Der Wirtschaftsboom der Neunzigerjahre erhöhte die Lust auf Exquisites auf dem Teller. Das kann dank besseren Versandarten sicherer und weiter weg verschickt werden. Binnen 36 Stunden gelangen die teuren Produkte von Corea nach Korea. Lebend. Ein toter Hummer ist nämlich ein wertloser Hummer. Innert Minuten vergammelt die Delikatesse zum toxischen Stinktier. Nichts riecht übler als sein stechender Verwesungsgestank. Wer selber Hummer kocht, muss demnach mit einer Grausamkeit fertig werden: lebendige Hummer Kopf voran ins siedende Wasser zu werfen.
Seit über vierzig Jahren fischt Colby Young, 62, ein früherer Marinesoldat, nach dem Krustentier. «Unsere Industrie ist gesund», sagt Young, dessen Familie schon seit sieben Generationen von Corea aus nach Hummern[90] jagt. Er selbst sei ein unerschütterlicher Optimist. «Mein Enkel fängt Hummer und sein Enkel wird ebenfalls Hummer fangen.» Den Fischern misst er das grösste Verdienst für die gesunden Bestände bei. Lange bevor sich die Politiker Gesetze ausdachten, hätten sie freiwillig Massnahmen ergriffen, die erst viel später festgeschrieben wurden. «Wenn man uns in Ruhe lässt, kommts am besten.»
Ein Grund für das prächtige Gedeihen der Hummer ist gewiss der Umstand, dass er im Vergleich zu anderen Meerestieren auf sanftere Art gefangen wird. Crevetten und Jakobsmuscheln starben in Maine längst aus, weil sie mit Netzen gefangen wurden. «Alles, was in ein Netz geht, stirbt», erklärt Young. Im Unterschied zu Netzen zerstören Reusen die Meeresfauna nicht.
Sämtlichen Laich tragenden Weibchen wird ein «V» in den Schwanz gestanzt, das auch nach einer Häutung bleibt – das Tier ist für immer sicher vor den brodelnden Töpfen der Gourmets. Freiwillig werfen Maine-Lobstermen alle gestanzten Hummerweibchen zurück. Ebenso wenn ein Lobster-Rumpf zu lang – über 12,7 Zentimeter – oder zu kurz – unter 8,25 Zentimeter -, ist. Babys kriechen rasch in die Reuse rein, laben sich am Köder – und entkommen problemlos durch die extra für die Winzlinge bestimmte Öffnung im eng gewobenen Gerüst.
Alle Versuche, Hummer zu züchten, schlugen fehl
Die Hummerfischer haben sich noch weitere Regeln auferlegt: An Sommersonntagen bleiben die Boote im Hafen. Die Anzahl Reusen pro Fischer ist auf 800 beschränkt. Durchaus auch zum Schutz der Fischer sind die Gesetze, die der Bundesstaat Maine auf ihr Betreiben hin einführte. So kriegen nur Schiffsbesitzer die Lizenz zur Hummerjagd, was verhindert, dass kapitalstarke Unternehmer ganze Flotten loslassen. Und bevor das Fischereiamt eine neue Lizenz ausstellt, müssen vier alte Fischer in Pension gehen.
Leicht ist es nicht, den knochenharten Beruf zu ergreifen. Fremde schaffens selten. «Du musst schon in Corea geboren sein», sagt Jean Symonds, «sonst hast du hier keine Chance.» Die 68-jährige Symonds ist eine Ausnahme. Als einzige Frau fischt die Grauhaarige in der Corea-Co-op mit. Als Auswärtige. Vor dreissig Jahren kam die einstige Sanitätssoldatin aus Massachusetts nach Maine – und wurde prompt akzeptiert. Als Armeeangehörige bekam sie die Lizenz ohne die übliche Wartezeit. Wer die Erlaubnis hat, muss vor allem auch Geld haben: Boot und Fallen allein kosten 300’000 Dollar, die stinkenden Köder nochmals 15’000 Dollar jährlich.
Versuche, Hummer ähnlich wie Salm, Crevetten oder Wolfsbarsche in Farmen zu züchten, schlugen bisher fehl. Dennoch ähnelt die Hummerfischerei in Maine einer Massentierhaltung, wenn auch unter natürlichen Bedingungen. Die Fischer mästen ihre Beute regelrecht. «Ich weiss nicht, ob wir die Lobster jagen oder die Lobster uns folgen», sagt Symonds. Hunger kennen hiesige Hummer nicht. Der erste Schritt zur Farm? «Der Tag wird kommen, an dem man Hummer erfolgreich züchtet», fürchtet Fischerin Symonds. «Dann verschwindet hier eine ganze Lebensweise.»
Verschwunden sind bereits die natürlichen Gefahren. Frassen früher Millionen hungriger Dorsche zum Imbiss ein Dutzend Babyhummer, ist dieser Feind heute weit gehend ausgefischt. Ebenfalls selten geworden sind Robben – auch sie Lobster-Liebhaber.
Echte Gefahr aber lauert in Kanada. Dort subventioniert der Staat riesige Verarbeitungsfabriken, ständig hungrig nach frischem Hummerfleisch. Diese Anlagen haben das Spiel von Angebot und Nachfrage gänzlich aus dem Gleichgewicht gebracht. «Doppelt so viel» könnte Dwight Rogers verkaufen, sogar im Sommer, früher eine ruhige Zeit. Zuvor galt Hummer als Festtagsschmaus, an Weihnachten oder Neujahr. Seit die Fabriken in Kanada die Viecher kochen und ultraschnell gefrieren oder zu Salat und Raviolifüllung verarbeiten, bleiben Nachfrage und somit der Preis konstant hoch. Kein Wunder, ziehen die Maine-Lobstermen nun alljährlich neunzig Prozent des zum Fang freigegebenen Bestandes an Bord. Denn über sechzig Prozent des Fangs nehmen die nimmersatten Fabriken ab.
Selbst die Limitierung auf 800 Fallen schützt nicht vor Überfischung. Alle nützen die Limiten aus. Nie zuvor waren mehr Reusen im Wasser.
Es ist eng geworden auf dem Meer vor Maine. An Minen- oder Konfettifelder erinnern die idyllischen Buchten. Boje reiht sich an Boje, total über zwei Millionen Stück. An jeder baumelt eine Hummerreuse. Wochenendkapitäne klagen, es sei noch nie so schwierig gewesen, Schiffe durch die Jagdgründe zu manövrieren.
Zuweilen kämpfen die Fischer erbarmungslos um ihre knappen Territorien. «Mancherorts schwelen Lobster-Kriege», sagt Randy Anderson. Fische ein Boot in fremden Jagdgründen, stecke anderentags schon mal ein Messer in der Boje. Zieht der Eindringling trotz der Warnung nicht schnurstracks ab, muss er mit dem Verlust sämtlicher Reusen rechnen.
Der Lobster-Hub für die Welt ist Deer Island in Kanada
Aus dem Lautsprecher dröhnt «Satisfaction» von den Stones. Angenehm wärmt die Sommersonne. Es ist halb fünf am Nachmittag, die meisten Boote haben im Hafen von Corea angelegt und den Fang der Co-op abgeliefert. Rogers und zwei Vorarbeiter laden Kiste um Kiste in einen kanadischen Kühlwagen. Nach drei Stunden erreicht die Ware Deer Island, jenseits der US-kanadischen Grenze. Der Lobster-Hub für die Welt. Von den kanadischen Provinzen Nova Scotia und New Brunswick und von Maine treffen beim weltweit grössten Hummerexporteur East Coast Seafoods Krabbeltiere ein. Auf trockenes Eis gelegt und in Kartonschachteln verpackt, werden die Viecher von Trucks nach Boston, New York und Philadelphia gefahren, «wo immer freier Frachtraum in Flugzeugen erhältlich ist», sagt Stuart McKay von East Coast Seafood. Drei Viertel gelangen nach Europa, zehn Prozent nach Asien, «Tendenz steigend», sagt McKay. Vornehmlich in Japan und Südkorea werde die nordatlantische Delikatesse zunehmend beliebter. Zwei von hundert Tieren sterben auf dem Transport – von Corea nach Korea.
Aasgeier der Ozeane
Verwandt ist der Hummer mit der Kakerlake und den Spinnen. Der Allesfresser gilt als Staubsauger und Aasgeier der Ozeane. Ein hungriges Männchen frisst selbst die eigenen Jungen. Je nach Alter legen Hummer ein- oder mehrmals jährlich den Panzer ab. Weibchen schlüpfen zur Fortpflanzung extra aus der dicken Haut. Biologen beschreiben zwei «homarus»-Arten: erstens den kleineren, vornehmlich in Europas Norden anzutreffenden «homarus gammarus» oder europäischen Hummer. Die delikatere und grössere Sorte der «homarus americanus» – kommt entlang der Ostküste vor, von North Carolina bis nach Labrador in Kanada. Wobei nirgends mehr von der Luxusspeise aus dem Meer gezogen wird als im kleinen Bundesstaat Maine. In Kanada und den USA werden jährlich rund 60’000 Tonnen Hummer gefangen und weltweit verkauft. Vor 20 Jahren waren es noch 20’000 Tonnen gewesen. Maine trägt mehr als die Hälfte zur nordamerikanischen Produktion bei. Drei Viertel der amerikanischen Hummer gelangen nach Europa, vor allem nach Frankreich und Italien, dann folgen Deutschland und die Schweiz. 15 Prozent werden in den USA selbst verspeist, 10 Prozent in Japan und Korea.�

Ist das wirklich einen Gaumenschmaus wert? Allein der Transport ist für die Teire eine Tortur. “Todesangst” bescheinigt auch der Autor den Tieren, die wieder in das Meer geworfen werden und auch der Biologe Claude Pasquini betont, dass auch diese Lebewesen fühlen! Nicht nur der äußerst qualvolle Tod des Hummers, der lebendig gekocht wird – und es dauert eine viel zu lange Zeit, bis das Tier dann wirklich tot ist – welche Qualen mögen das sein!!!! – sondern auch das qualvolle Warten während des Transportes und gefesselt im viel zu engen Becken eines Restaurants oder Händlers – alles das ist eine grauenhafte Tierquälerei. oft werden sogar die Fühler – Tastorgane der Tier! – abgebrochen! Ein Genuss mit “gutem Gewissen”? Darunter stelle ich mir etwas anderes vor! Ich selbst verzehre seit ca. ¹5 Jahren weder Fisch ncoh Fleisch – und bin glücklich damit. Leben und leben lassen!
Es gibt wissenschaftliche Studien, die aussagen, dass Hummer ein größeres Schmerzempfinden haben als der Mensch. Kein normal denkender Mensch kann sich ein zu Tode verbrühtes Tier mit Genuss einverleiben und dabei auch noch ein gutes Gewissen haben.
Meine Vorrednerinnen haben bereits alles gesagt. Nur noch eines: Laut aktueller Erkenntnisse dauert es rund 15 (in Worten: fünfzehn) Minuten, bis so ein Hummer in heißem Wasser stirbt und die tiefrote, dem “Gourmet” ach so köstliche Färbung annimmt. Abgesehen von den übrigen Qualen, die diese bedauernswerten Geschöpfe zu diesem Zeitpunkt bereits hinter sich haben. Wer da mit “gutem Gewissen” zugreift, kann keines haben.
Es gibt wissenschaftliche Studien, die aussagen, dass Hummer ein größeres Schmerzempfinden haben als der Mensch. Kein normal denkender Mensch kann sich ein zu Tode verbrühtes Tier mit Genuss einverleiben und dabei auch noch ein gutes Gewissen haben.
Wenn man um die Tatsache weiß, dass Hummer Schmerz empfindende Lebewesen sind, ist die Vorstellung, dass sie lebend in kochendes Wasser geworfen werden, eine absolute Ungeheuerlichkeit und Unmenschlichkeit! Wer kann eine solche Barbarei gedankenlos hinnehmen und sich das gequälte Fleisch der Hummer noch “auf der Zunge zergehen lassen”? Eine absolute Geschmacksverirrung und verabscheuungswürdige Dekadenz!
Shame about this torture at Hummers.
15 Minuten Todeskampf im heissen Wasser,Tiere, die verzweifelt versuchen aus dem Topf zu krabbeln (bestätigt jeder Koch)wie dumm und gefühllos muss man sein um das zu essen?
Die Ignoranz der sogenannten Feinschmecker (und sonstigen Fleischesser) in Bezug auf die Leiden der verspeisten Opfer ist himmelschreiend, wie hier einmal mehr bewiesen wird!
Hummer leiden still, würden Sie es nicht tun, würden sicherlich sehr viele
davon Abstand nehmen, die Tiere zu halten, sie anzubieten oder zu essen .
Die Tatsache, daß Hummer ihr Leiden nicht artikulieren können, bedeutet
nicht, daß sie es nicht tun, denn sie besitzen ebenfalls ein Nervensystem.
Der Todeskampf ist qualvoll, erst wenn ihr Nervensystem durch das Kochen
zerstört ist, was bis zu fünf Minuten dauert, ist ihr Leiden beendet.
Zweifelsfrei leiden die Tiere wenn sie lebend ins heiße Wasser geworfen
werden, sie versuchen dem Kochtopf zu entfliehen und spätestens hier kann
keiner mehr leugnen, daß die Tiere kein Empfinden haben.
Bevor die Tiere in einem Restaurant landen, haben sie bereits eine
wochenlange Tortur hinter sich. Da es Hummer in Deutschland so gut wie
nicht mehr gibt, werden sie u.a. aus den USA und Kanada importiert. Von
dort aus werden sie in engen, dunklen Kisten mit zusammengebundenen
Scheren, ohne Futter, verpackt und auf die weite Reise geschickt.
Wochenlang sind die Tiere oft bewegungslos in Kisten gestapelt, bis sie an
ihrem Zielort ankommen. Das Martyrium findet kein Ende, denn auch beim
Fischhändler sitzen sie weiterhin in engen Becken ohne Nahrung. Von
lebenden Toten in eisigen Särgen wird gesprochen, aber sie müssen leben und
leiden…und selbst ein schmerzfreier schneller Tod ist ihnen nicht
beschieden.
Auch namhafte Spitzenköche beziehen inzwischen Stellung gegen das
barbarische Lebendkochen von Hummern und sprechen von dem Märchen, das
Hummer, wenn sie in siedend heißes Wasser geworfen werden , sofort tot
sind. Hummer zu essen ist grausam, das sollte sich jeder bewußt machen, der
sich an dem Kauf -und Verkauf dieser Meerestiere beteiligt.
Sich sein Opfer lebend auszusuchen, um es in
kochendes Wasser werfen zu lassen, ist kein Zeichen für Luxus und Etikette.
Ein Umdenken im Umgang mit wehrlosen Wesen ist dringend angebracht und
jeder sollte darauf verzichten, sich an solch einem barbarischen “Schmaus”
zu beteiligen.
Wir brauchen diesen Gaumenkitzel wahrlich nicht, es gibt reichlich
Alternativen, die gleichfalls Genuß bedeuten.
Wäre ich katholisch gestimmt, würde ich an “Auge um Auge – Zahn um Zahn” denken und den Mördern (von Tieren) den gleichen Tod wünschen, wie sie ihn ihren Opfern bereiten bzw. bereiten lassen, wenn sie den Mord in Auftrag geben. Ich denke die Zahl der Menschen, die Tiere essen, würde rapide abnehmen.
Ich mag Fleisch nur warm- UND LEBENDIG!
stimmt es das ein Hummer eigentlich nicht an einem natürlichen Tod sterben kann?
Ich habe das aufgeschnappt, aber bisher im Internet nichts darüber gelesen. Das sie Kanibalen sind ist mir bekannt, aber das sie nicht an altersschwäche sterben sollen ist mir neu.
MFG Matze